Buch der Synergie
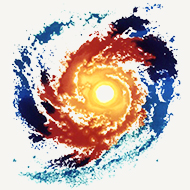
| Blättern |
 TEIL C
TEIL C
Elektro- und Solarschiffe (VIII)
2013 (B)
Weiter mit der Jahresübersicht 2013 - in Form eines zweiten Schwerpunkts,
der die Entwicklungen bei Elektro- und Hybridfähren sowie Wassertaxis betrifft.
Die Wichtigkeit dieses Sektors belegt ein Bericht des Branchenverbands Interferry in Seattle aus dem Jahr 2024, dem zufolge Fähren weltweit jährlich rund 4,2 Milliarden Passagiere und 370 Millionen Fahrzeuge befördern. Nach Angaben des Maritime Battery Forum sind 2021 weltweit aber noch immer nicht mehr als 130 batterieelektrische Fähren in Betrieb. Viele von ihnen lassen sich in Dänemark, Norwegen und Schweden finden.
Anschließend wird die Entwicklung in weiteren Ländern betrachtet, geordnet nach ihrem erstmaligen Auftreten in der Presse. Diese Ordnung ist sinnvoller als eine alphabetische, da sie einen chronologischen Kontext des Geschehens bietet. Zudem kann man von hier aus direkt zu den betreffenden Ländern springen: Frankreich - Niederlande - Finnland - USA - Deutschland - Taiwan - Schweiz - Großbritannien - Thailand - Island - China - Kanada - Griechenland - Malta - Indien - Südkorea - Portugal - Italien - Neuseeland - Singapur - Malaysia - Kroatien - Spanien.
Beginnen wir also mit Dänemark,
wo die Presse im Mai 2013 berichtet, daß die deutsch-dänische
Fährgesellschaft Scandlines damit begonnen habe, eines
ihrer mit Diesel betriebenen Schiffe in ein dieselelektrisches Hybridschiff umzubauen.
Die Fährgesellschaft hat hierzu die Umrüstung der 140 m langen Prinsesse
Benedikte in Auftrag gegeben, die von der Werft Ørskov
Christensen Staalskibsværft in Frederikshavn gebaut und 1997 in
Dienst gestellt worden war, um auf der etwa 17,5 km langen Strecke
zwischen dem dänischen Rødbyhavn und Puttgarden in Deutschland 300
Fahrzeuge und 900 Passagiere zu befördern. Sie wird durch rund 17,5
MW starke Dieselmotoren angetrieben.
Die Umrüstung erfolgt durch ein 2,7 MWh (andere Quellen: 2,9 MWh) Energiespeichersystem aus 399 modernen Lithium-Polymer-Batterien des Typs Corvus Energy AT6500, die kein Kühlsystem benötigen und in die Antriebssysteme von Siemens integriert sind. Damit wird das Schiff in der Lage sein, in einem Hafen allein mit elektrischer Energie zu fahren, wobei die Batterien das 16.000 Tonnen schwere Schiff etwa 30 Minuten lang ohne Dieselkraftstoff antreiben können. Aufgeladen werden sie mit Landstrom oder Generatorstrom, was ebenfalls 30 Minuten dauert.

Die Umrüstung soll Scandlines nicht nur Kraftstoff, sondern auch Wartungskosten sparen, da geschätzt wird, daß sich die Lebenserwartung des Schiffsdieselaggregats durch den Einbau der Batterien verdreifacht. Zudem sollen die Treibhausgasemissionen und die Lärmbelastung gesenkt werden. Insgesamt wird erwartet, daß sich die Batterien innerhalb von fünf Jahren amortisieren, da der Treibstoffbedarf der Fähren um 15 - 20 % sinkt.
Die erneuerte Prinsesse Benedikte mit dem Spitznamen ,Prius der See’, die im September wieder in den Einsatz geht, ist ein so großer Erfolg, daß im Folgejahr 2014 auch die drei anderen Fährschiffe der seit 1963 bestehenden Vogelfluglinie Hybridantriebe eingebaut bekommen: die Prins Richard, die Deutschland und die Schleswig-Holstein. An den Kosten von 25 Mio. € beteiligt sich die EU mit 6,4 Mio. €.
Auch beim Bau der neuen Fähren für 460 Fahrzeuge und 1.300 Passagiere, die ab 2016 auf der Route Rostock-Gedser in Betrieb genommen werden sollen, entscheidet sich Scandlines für Hybridfähren, bei denen einer der ursprünglich fünf Dieselmotoren durch eine Batterie mit einer Kapazität von 1,6 MWh ersetzt wird. Ein reiner Elektrobetrieb ist auf dieser Route nicht zu verwirklichen, da die beiden neuen Schiffe Berlin und Copenhagen eine Stunde länger unterwegs sind als die Fähren der Vogelfluglinie und deutlich mehr Batteriekapazität benötigen würden, um die komplette Strecke elektrisch zu bewältigen.
Im Oktober 2015 berichtet die Presse jedoch, daß die Scandlines plant, ab 2018 oder 2019 alle Schiffe komplett elektrisch und abgasfrei zu betreiben. Die Reederei habe dafür Investitionsmittel von 50 - 60 Mio. € vorgesehen, die Pläne seien aber noch nicht vollständig ausgereift, da auch Wind und Wasserstoff zum Antrieb der Schiffe genutzt werden könnten.
Der Entwickler von großen Lithium-Batterie-Energiespeichersystemen Plan B Energy Storage (PBES) und der Batteriehersteller XALT Energy LLC schließen im September 2016 einen Liefervertrag für Batteriezellen für die beiden Fähren von Scandlines für 238 Fahrzeuge und 1.100 Passagiere auf der Strecke Helsingborg – Helsingør, die jeweils mit 4,16 MWh (andere Quellen: 4,5 MWh) Batteriepacks ausgestattet werden sollen, um den Primärantrieb mit Strom zu versorgen. Das von PBES entwickelte Energiespeichersystem verfügt über ein besonderes Flüssigkeitskühlsystem, das in der Schiffahrt ein höheres Maß an Sicherheit bietet.
Diese Elektrofähren werden jährlich mehr als 7,4 Mio. Passagiere und 1,9 Mio. Fahrzeuge befördern. Dieses Projekt wird von der INEA, der Exekutivagentur der Europäischen Union für Innovation und Netze, mit umgerechnet 14,1 Mio. $ unterstützt.

an der
Prinsesse Benedikte
Ein weiterer Schritt wird der Austausch aller Thruster – der Antriebssysteme der Fähren, zwei vorne, zwei hinten – auf den vier Hybridfähren der Route Puttgarden - Rødby sein. Die neuen Hightech-Pull-Thruster von Kongsberg Maritime sollen weniger Unterwasserlärm und geringere Vibrationen erzeugen und dazu beitragen, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Die Gesamtinvestition beträgt mehr als 13 Mio. €. In welchem Umfang sich die Lärmemissionen tatsächlich verringern lassen, wird im Rahmen einer durch den Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) begleiteten Meßkampagne ermittelt.
Einige Jahre später erfolgt die Umsetzung: Als erste der insgesamt vier Scandlines Hybridfähren wird die Schleswig-Holstein im Herbst 2019 mit jeweils vier neuen Thrustern ausgestattet, die sich um die senkrechte Achse drehen und dadurch auch als Ruder dienen. Die Deutschland ist ab April 2020 mit dem neuen Schiffsantrieb unterwegs und die Prins Richard ab September 2021. Die Prinsesse Benedikte folgt schließlich im September 2022.
Auch die weitere Elektrifizierung der Routen geht voran. So wird im Mai 2024 gemeldet, daß Scandlines die Firma Wärtsilä Marine (s.u.) als Lieferant für die elektrischen Systeme der Passagierfähren Schleswig-Holstein und Deutschland ausgewählt habe, die gewährleisten sollen, daß etwa 80 % der für eine Überfahrt benötigten Energie elektrisch sind. Die Umrüstung zu Plug-in-Hybridfähren sei Teil des Ziels, die Strecke Rødby - Puttgarden bis 2030 ohne direkte Emissionen zu betreiben und die Vision des Unternehmens von null direkten Emissionen bis 2040 zu verwirklichen.
Bei den Umrüstungsarbeiten, die bei der Firma Western Shiprepair in Litauen im August 2025 beginnen und Anfang des Folgejahrs abgeschlossen sein sollen, wird ein Dieselgenerator entfernt und durch ein 5 MWh Energiespeichersystem ersetzt.
Um chronologisch mit Dänemark fortzufahren: Hier ist
auch der ,The Blue Denmark’ genannte Plan des dänischen Ministeriums
für Industrie, Wirtschaft und Finanzen erwähnenswert, der im Januar 2018 eine
Reihe von Initiativen zur Stärkung der maritimen Entwicklung vorstellt
und 36 Wachstumspotentiale beschreibt, von denen eines die Modernisierung
der Fähren betrifft, die die vielen kleinen bewohnten Inseln mit dem
Festland verbinden. Derzeit gibt es bis zu 70 verschiedene kleine Fähren,
weil jede der Inseln ihre eigene gebaut hat.
Von den Gemeinden, deren Einwohner auf Inseln mit Fährverbindung leben, haben sich bereits 18 in der Fährvereinigung faergesekr.dk zusammengeschlossen, um u.a. die Entwicklung einer billigen und flexiblen Standardfähre zu unterstützen. Um das Projekt in Gang zu bringen, wird zunächst von der Firma Odense Maritime Technology eine Testfähre gebaut, die 40 - 50 Mio. DKK kosten wird. Sie soll zu Versuchszwecken oder dann eingesetzt werden, wenn eine der eigenen Fähren der sechs Inseln ausfällt, die sich bereits für die Nutzung angemeldet haben.
Die Größe der Fähre basiert auf einer Untersuchung von 50 kleinen dänischen Fährrouten: Länge 36,6 m, Breite 11,6 m, maximale Tiefe 2,3 m, Betriebsgeschwindigkeit 12 Knoten. Das Konzept wird an beiden Enden über einen Antrieb verfügen, und die Gesamtstruktur wird von vorne nach hinten symmetrisch sein, um keine Zeit mit Wenden zu verlieren.
Die erste Fähre, die im Folgejahr in Betrieb genommen werden soll, wird eine Kapazität von 120 Passagieren bei 75 Sitzplätzen innen und 19 Pkw oder 2 Lkw + 12 Pkw haben. Sie wird sowohl mit einem Verbrennungsmotor als auch mit einem Elektromotor ausgestattet sein, da es aufgrund fehlender Ladestationen an Land zunächst nicht möglich ist, die Fähren ausschließlich mit Strom anzutreiben, wie es aber langfristig geplant ist.
Im Jahr 2018 werden auch die von der schwedischen
Reederei Øresundslinjen (früher: ForSea Ferries, HH
Ferries Group) betriebenen Dieselfähren Tycho Brahe und Aurora (o.
Aurora af Helsingborg), die seit 1991 die dänische
Stadt Helsingør mit Helsingborg in Schweden verbinden, auf batterieelektrischen
Betrieb umgerüstet - und zwar von dem schwedisch-schweizerischen Energie-
und Technologiekonzern ABB Ltd. (Asea Brown Boveri).
Die Umrüstung wird von der EU mit rund 13,15 Mio. € unterstützt.

Die 110 m langen, 28,2 m breiten und 11.148 Tonnen schweren Fähren können jeweils bis zu 1.100 Passagiere und 238 Fahrzeuge transportieren. Die größere Aurora hat sogar Platz für 1.250 Passagiere. Die Fahrstrecke ist circa 4 km lang, wird in rund 20 Minuten bewältigt und verbraucht ca. 1,17 MWh.
Die neu installierten, von PBES entwickelten Batteriecontainer wiegen 80 Tonnen und haben anfangs 4,16 MWh Kapazität, was später auf 6,4 MWh erweitert wird. Die wassergekühlten Batteriepakete bestehen aus 640 Lithium-Ionen-Modulen von XALT Energy, die in 32"-Containern auf dem Deck untergebracht sind.
Während der 20-minütigen Überfahrt, die etwa 1.175 kWh verbraucht, werden die Batterien um 29 % entladen - von 85 auf 56 % der maximalen Kapazität. Daher gibt es eine Batteriereserve, die es ermöglicht, auch bei stürmischem Wetter usw. sicher zu fahren. Das Aufladen der Batterien mit 10 MW während der kurzen Hafenaufenthalte dauert 5 - 9 Minuten und erfolgt mittels eines ebenfalls von ABB installierten 3D-lasergesteuerten Industrieroboterarms, der sich auf einem 10 m hohen Turm befindet und sich das Ladekabel automatisch schnappt, sobald das Schiff einläuft.
Allerdings zeigt sich, daß die Technik nicht frei von Tücken ist: Als die Reederei ihren Namen von HH Ferries in ForSea ändert, erhalten die Fähren einen neuen Anstrich. Danach haben die Laderoboter Schwierigkeiten, sich an die Ladekabel anzuschließen. Es erweist sich, daß im späten Frühjahr, zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag, das Sonnenlicht aus einem Winkel kommt, der Reflexionen erzeugt und die Fähigkeit der KI-Technologie beeinträchtigt, den Anschluß des Ladekabels zu erkennen.
Unter diesen Bedingungen verursachen die Sonne und die weiße Farbe Kontrastprobleme, die zu falschen Referenzpunkten, sogenannten Geisterpunkten, führen, die den 3D-Scanner verwirren. Um das Problem zu lösen, wird ein System entwickelt, mit dem die Referenzpunkte genauso sichtbar werden, wie der 3D-Scanner sie sieht. Auf diese Weise lassen sich die Geisterpunkte einer nach dem anderen finden. Darüber hinaus werden Bereiche, die möglicherweise Reflexionen verursachen könnten, mit einer mattschwarzen Farbe bemalt - als die einfachste Lösung.
Auch das Belüftungssystem wird auf den neuesten Stand gebracht, und die überschüssige Wärme der Batterien wird zur Beheizung der Fähren genutzt. Eine weitere Besonderheit ist, daß die Fähren während der Überfahrt auch Elektroautos mit Schnelladegeräten laden können, was eine Reichweite von zusätzlichen 250 km für die Autos ermöglicht. Der Gesamtenergieverbrauch der Fähre ist im Batteriebetrieb etwa 40 % geringer als im Dieselbetrieb.
Im Mai 2024 erteilt Øresundslinjen dem schwedischen Batteriehersteller Echandia einen Auftrag zur Umrüstung der M/S Hamlet von fossilen Brennstoffen auf einen vollständig elektrischen Betrieb. Das Schiff, das Platz für 1.000 Passagiere und 240 Autos bietet, fährt auf der Strecke zwischen dem schwedischen Helsingborg und Helsingør in Dänemark und durchquert die Öresundstraße bis zu 8.000 Mal pro Jahr.
Das Batteriesystem, das in beiden Häfen in durchschnittlich nur elf Minuten wieder aufgeladen werden kann, ist für eine Mindestbetriebsdauer von zehn Jahren ausgelegt und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ausgeliefert werden.

ÆrøXpressen
(Grafik)
Im Dezember 2018 wird gemeldet, daß die dänische
Werft Hvide Sand dem deutschen Hersteller elektrischer
Automatisierungs- und Antriebssysteme Baumüller den
Auftrag erteilt hat, das gesamte Antriebssystem für eine Hybridfähre der
Fährgesellschaft ÆrøXpressen zu liefern, die ab Herbst
des Folgejahres für eine Verbindung zwischen den Häfen Ærø und
Rudkøbing im südlichen Dänemark sorgen und bis zu 32 Pkw und 196 Passagiere
befördern soll.
Das Antriebssystem, das aus der Elektromaschine, dem Dieselgenerator, den Antrieben für Propeller und Bugstrahlruder, einem Energieverteilungssystem und der Bordnetzspannungserzeugung besteht, bildet eine dieselelektrische Hybridlösung, bei der die Fähre von Elektromotoren angetrieben wird, die Dieselaggregate sind nur zur Stromerzeugung an Bord. Innerhalb der Häfen läuft die Fähre vollelektrisch. Sie kommt auf ca. 20 km/h. Ebenfalls 2018 hat Baumüller eine hybride Fähre in Deutschland mitgebaut und eine vollelektrische Fähre in Asien ausgerüstet.
Im Juni 2019 wird in Dänemark die zu dieser Zeit leistungsstärkste vollelektrische
Fähre der Welt getauft, deren Jungfernfahrt dann im August
stattfindet, bevor sie im September in den regulären Betrieb integriert
wird. Der Rumpf der knapp 60 m langen und etwa 13 m breiten Elektrofähre Ellen (anfangs:
E-Ferry) kam zwei Jahre zuvor aus Polen und wurde seitdem auf der Søby
Werft auf der Insel Ærø mit einem vollelektrischen Antriebsstrang
der finnischen Danfoss Editron Oy ausgestattet, der
aus zwei 750 kW Antriebsmotoren und zwei 250 kW Strahlrudermotoren
besteht.

Danfoss Editron liefert auch das Energiemanagementsystem des Schiffes für die komplette automatische Energie- und Laststeuerung an Bord. Die Elektromotoren stammen ursprünglich von dem finnischen Unternehmen Visedo, das 2017 von Danfoss übernommen wurde und seitdem als Danfoss Editron firmiert.
Hinzu kommt ein 4,3 MWh Batteriepaket des Schweizer Unternehmens Leclanché SA, das hochenergetische G-NMC-Lithium-Ionen-Zellen mit besonderen Sicherheitsmerkmalen verwendet, darunter ein bi-zelluläres Laminatdesign und Keramik-Separatoren. Am Terminal in Søby befindet sich eine Hochleistungsladestation von Danfoss Editron, die die Batterie mit bis zu 4 MW (andere Quellen: 4,4 MW) Leistung aufladen kann.
Mit einer Hin- und Herfahrt von insgesamt ca. 40 km zwischen den dänischen Häfen Søby auf der Insel Ærø und Fynshav auf der Insel Als, und damit zwischen zwei Ladevorgängen, fährt die Ellen dem Betreiber Ærøfærgerne (o. Ærø Ferry) zufolge siebenmal weiter als jede andere Elektrofähre, die derzeit auf der Welt in Betrieb ist. Sie kann rund 30 Pkw oder fünf Lkw sowie 200 Passagiere befördern, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 15,5 Knoten (29 km/h) und soll bis zu sieben Hin- und Rückfahrten pro Tag absolvieren. Die Ellen ist außerdem die erste Elektrofähre, die kein Notstromaggregat an Bord hat.
Als im Juni 2020 die Ergebnisse von zehn Monaten im Einsatz vorliegen, zeigt sich, daß das ca. 21,3 Mio. € teure Projekt, von dem die EU im Rahmen der im Juni 2015 gestarteten und von Dänemark, Griechenland und Norwegen durchgeführten Initiative E-ferry zur Elektrifizierung von Schiffen einen Anteil von gut 15,1 Mio. € trägt, alle Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen hat. Die Energieeffizienz des gesamten elektrischen Systems liegt bei 85 %, was mehr als das Doppelte der Effizienz einer herkömmlichen Dieselfähre ist. Außerdem hat sich bewiesen, daß der elektrische Antrieb weniger kostet als der Dieselantrieb.
Im Juni 2022 stellt die Ellen einen Weltrekord auf, als sie mit einer einzigen Batterieladung eine Strecke von 92 km (50 Seemeilen) zurücklegt.

mit Rotorsegel
Über die nächsten Schritte für emissionsfreien Fährverkehr, die Scandlines plant,
wird im August 2019 berichtet: Demnach soll auf der
Fähre Copenhagen, die Rostock mit der dänischen
Insel Falster verbindet und bereits mit einem Hybridantrieb ausgestattet
ist, im zweiten Quartal 2020 zusätzlich noch ein Rotorsegel
der finnischen Firma Norsepower Oy installiert werden.
Bei dem Zylinder mit einer Höhe von 30 m und einem Durchmesser von
5 m handelt es sich um einen Flettner-Rotor,
der in einem eigenen Kapitelteil unter Windenergie ausführlich beschrieben
wird (s.d.).
Ein Rotorsegel hat die optimale Wirkung, wenn es stark windig ist und der Wind von der Seite kommt. Die Strecke zwischen Gedser im Norden und Rostock im Süden verläuft fast senkrecht zum vorherrschenden Wind aus Westen oder Osten. Das ergibt sehr günstige Bedingungen für den Einsatz von Rotorsegeln auf der Überfahrt, und Scandlines geht davon aus, daß die CO2-Emissionen durch den Rotor um 4 - 5 % gesenkt werden können.
Gegenüber seinem klassischen Vorgänger haben die Ingenieure bei Norsepower zudem wichtige Verbesserungen implementiert. So besteht der Zylinder inzwischen aus Kohlenstoff- und Glasfasern, was einerseits für Sicherheit und Stabilität sorgt, andererseits aber das Gewicht deutlich reduziert. Außerdem soll der Rotor einfacher zu nutzen sein und sich schneller drehen als in der Vergangenheit. Im Jahr 2022 wird auch auf der Berlin, die zwischen Rostock in Deutschland und Gedser in Dänemark verkehrt, ein Rotorsegel installiert.

(Grafik)
Im November 2021 bestellt Scandlines zudem bei der türkischen Werft Cemre Shipyard eine emissionsfreie Frachtfähre für die Strecke zwischen Puttgarden und Rødby, die von LMG Marin AS entworfen wurde. Der Baustart erfolgt im April 2022 und der Stapellauf findet im November 2023 statt.
Die 147,4 m lange und 25,4 m breite RoPax- oder Roll-on-Roll-off-Frachtfähre Futura (o. Zero Direct Emission Freight Ferry; auch PR24, für Puttgarden – Rødby 2024) wird mit einem 10 MWh Lithium-Ionen-Batteriesystem von Leclanché ausgestattet, das per Schnelladung in nur zwölf Minuten (andere Quellen: 17 Minuten) wieder aufgeladen werden kann. Dabei wird die Fähre mit Ökostrom versorgt.
Nach Installation der Technik und Ausrüstung sowie abschließenden Tests soll die Fähre Anfang (später: Herbst/Winter) 2025 auf der Route Puttgarden – Rødby in Dienst gehen, mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 10 Knoten. Im vollelektrischen, emissionsfreien Modus beträgt die Überfahrtzeit für die 18,5 km lange Strecke 70 Minuten, im Hybridfährenbetrieb und mit 16 Knoten nur 45 Minuten. Hierfür verfügt das Schiff über drei GenSets, die jeweils aus einem Dieselmotor und einem Generator zur Stromerzeugung bestehen.
Mit einer Frachtkapazität von 66 Lkw auf zwei Decks und einer maximalen Passagieranzahl von 140 Personen gilt die Futura zu diesem Zeitpunkt als die größte Hybrid-Passagierfähre der Welt. Die Kosten werden mit ca. 80 Mio. € angegeben. Eine Besonderheit ist die Programmierung eines digitalen Zwillings der PR24 in Scandlines Simulator in Puttgarden, damit die spätere Besatzung schon vor der Inbetriebnahme genug Zeit hat, das Fahren mit der Fähre zu üben.
Im Dezember 2023 folgt die Meldung, daß die Scandlines zwei Fehmarnbelt-Fähren auf der Puttgarden-Rødby-Strecke zu Plug-in-Fähren umrüsten will, wobei die Schiffe sowohl in Puttgarden als auch in Rødby mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgeladen werden sollen. Im Durchschnitt können die Batterien der Fähren in nur zwölf Minuten mit mindestens 80 % der für eine Überfahrt benötigten Energie geladen werden. Damit dies tatsächlich erfolgen kann, wird in drei Maßnahmen investiert: ein großes Energiespeichersystem, Ladevorrichtungen und erstmals auch Solaranlagen an Bord beider Fähren.
Die Gesamtinvestitionen für die Elektrifizierung der Fehmarnbelt-Fähren belaufen sich auf 31 Mio. €, von denen das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen eines Förderprogramms zur nachhaltigen Modernisierung von Küstenschiffen (NaMKü) bis zu 40 % trägt.

Arriva Denmark
Im Juli 2020 liefert die Damen Shipyards Group fünf emissionsfreie Elektrofähren des Typs 2306 an das Transportunternehmen Arriva Denmark A/S - Teil des britischen/internationalen Bahn- und Buskonzerns Arriva plc -, das sie für die dänische Verkehrsbehörde Movia in Kopenhagen betreiben wird.
Die vollelektrischen Fähren mit 120 kWh Akkus als Energiequelle und zwei E-Motoren mit einer Antriebsleistung von jeweils 55 kW haben ein innovatives Design, können jeweils 80 Personen mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 7 Knoten befördern, sind effizient im Betrieb und wirtschaftlich rentabel. Es sind keine Dieselgeneratoren installiert. Um die Ladezeit so kurz wie möglich zu halten, hatte Damen in Zusammenarbeit mit Echandia Marine, Heliox und Staubli ein innovatives Anlegesystem entwickelt, das das Ladesystem während des Anlegens automatisch mit dem Landstrom verbindet, so daß die Fähren an beiden Endpunkten der Fährroute in nur sieben Minuten aufgeladen werden können.
Das Projekt markiert die kommerzielle Einführung des neuen leichten und langlebigen, technisch fortschrittlichen Hochleistungsakkusystems mit LTO-Zellen (Lithium-Titanat-Oxid) von Echandia Marine, das unter Verwendung der SCiB-Technik des japanischen Elektronikgiganten Toshiba entwickelt wurde.

Darüber hinaus verfügt jede Fähre über eine Fernüberwachung durch ein Netzwerk von Sensoren, die in die Schiffe integriert sind. Dies ermöglicht die Verfolgung des Fahrtmusters, der Akkulebensdauer und der Wellendynamik und soll auch die Betriebseffizienz verbessern und die Wartungsausfallzeiten reduzieren.
Bei den Dutch Maritime Awards im November 2021 in Rotterdam wird Arriva Denmark für die E-Fähre Bryggen (o. Arriva II) mit dem Preis der Königlichen Niederländischen Vereinigung von Technikern für den Schiffbau (KNVTS) für das ,Schiff des Jahres 2021’ ausgezeichnet. Das dänische Geschäft - ab 2010 Teil der Deutschen Bahn - wird 2023 an die ebenfalls deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares verkauft und firmiert seit Anfang 2024 als GoCollective.

(Grafik)
Im Dezember 2020 berichtet die Fachpresse, daß Dänemark und Norwegen bis 2027 die weltweit größte und leistungsstärkste Wasserstoffähre bauen wollen, die bis 1.800 Passagiere zwischen Kopenhagen und Oslo befördern soll. Die mit einer 23 MW Brennstoffzelle ausgestattete Fähre wird von der dänischen Reederei Forenede Dampskibs-Selskab A/S (DFDS) betrieben und den Namen Europa Seaways tragen.
Auf Ihrer rund 48 Stunden dauernden Rundfahrt kann die Fähre auch Fahrzeuge befördern, entweder 380 Pkw oder 120 Lkw. Der dänische Windkraftriese Ørsted wird dazu beitragen, den grünen Wasserstoff mit Hilfe von Offshore-Windenergie bereitzustellen.
Ende 2021 wird Dänemarks einzige Schleppseilfähre, die seit 1967 besteht, nach einem Umbau durch die Assens Shipyard erneut in Betrieb genommen, doch nun völlig emissionsfrei.

Kabelfærge
Die Udbyhøj-Kabelfærge hat hierzu zusätzlich zu den Stahlkabeln, an denen sie sich über das Wasser zieht, ein 250 m langes, auf einer Trommel an der Seite des Schiffes aufgerolltes Elektrokabel erhalten, das sich während der Überfahrt abrollt und die Fähre mit Landstrom versorgt - und damit teure und schwere Batterien obsolet macht.
Die damit wortwörtliche Elektrokabelfähre, die zwischen den Häfen Udbyhøj Nord und Udbyhøj Syd die Mündung des Randers Fjords überquert, befördert 70.000 Personen pro Jahr mit durchschnittlich 88 Fahrten pro Tag. Gelegentlich muß sie anhalten, um die Führungsseile zu lockern und Verkehr mit Tiefgang passieren zu lassen - wie alle Seilfähren. Aber das elektrische Kabel wird einfach wieder auf dem Schiff aufgerollt. Betrieben wird die Fähre gemeinsam von den Gemeinden Randers und Norddjurs.
Im Januar 2023 wird berichtet, daß der australische
Hersteller von Hochgeschwindigkeitsfähren Incat Tasmania Pty
Ltd. gemeinsam mit dem Studio Revolution Design eine
Katamaran-Fähre mit Elektroantrieb entworfen hat, die Platz für 2.100
Passagiere und 226 Fahrzeuge bietet und damit deutlich größer ist als
die bisher bekannten Modelle. Ursprünglich wollte das Unternehmen eine
Fähre mit LNG-Antrieb bauen, doch 2022 entschieden
sich die Ingenieure um, weil Fähren regelmäßig einen Hafen ansteuern
und genug Zeit zum Laden der Akkus haben, während die Passagiere von
Bord gehen und neue Fahrgäste aufgenommen werden.

(Grafik)
Bei Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, ist ein Elektroantrieb derzeit noch keine Option, da sie teilweise Wochen auf See sind und unterwegs keine Möglichkeit zum Laden der Akkus haben.
In ihrer finalen Version kommt die 130 m lange Elektrofähre, angetrieben von zwei 9,6 MW Elektromotoren unter dem Schiffsrumpf, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten (46,3 km/h), während die Reichweite bei rund 185 km liegt. Dies reicht aus, um potentiell die Mehrzahl der heutigen Fährverbindungen zu bedienen.
Bei dem nun beginnenden Bau im Incat-Werk in Hobart in Tasmanien, der gut zwei Jahre dauert, wird auch ein Fortschritt beim Gewicht gemacht: Zwar werden 400 Tonnen Akkus von Corvus Energy mit mehr als 40 MWh verbaut, doch demgegenüber werden Tanks und Equipment mit einem Gesamtgewicht von 500 Tonnen obsolet. Perspektivisch ist zudem angedacht, statt Stahl verstärkt Aluminium zu nutzen.

Das erste Exemplar des derzeit weltweit größten vollelektrischen Passagier- und Fahrzeugschiffs Hull 096 wird an die in Uruguay beheimatete Firma Buquebús (o. Los Cipreses S.A.) verkauft, die bereits einige Fähren auf dem südamerikanischen Kontinent betreibt und auch langjähriger Kunde der Incat ist.
Nach ihrer Auslieferung 2025 soll die inzwischen auf den Namen China Zorrilla getaufte Elektrofähre, die auch unter dem Namen Dolphin NextGen ESS bekannt ist - aufgrund der leichten Batterie von Corvus, der Dolphin NextGen - eine Verbindung zwischen Uruguay und Argentinien bedienen und bis zu 2.100 Passagiere und 225 Fahrzeuge über den Río de la Plata befördern.
Tatsächlich wird das Schiff Anfang Mai vom Stapel gelassen. Nun ist aber nur noch von über 250 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien die Rede, wobei der gesamte Lieferumfang des von Wärtsilä gelieferten Energiespeichersystems neben den Batteriemodulen auch das Energiemanagement, die Stromumwandlung, das Gleichstrom-Landanschlußsystem, den Gleichstrom-Hub, acht Elektromotoren, acht Axialströmungs-Wasserstrahlantriebe und das Antriebssteuerungssystem ProTouch umfaßt.

(Grafik)
Nach Angaben von Wärtsilä zeichnet sich die elektrisch angetriebene Wasserstrahlkonfiguration durch einen niedrigen Achterstand und geringen Tiefgang sowie eine verbesserte Manövrierfähigkeit dank der integrierten Steuerung aus. Darüber hinaus steigern die Wasserdüsen die Gesamteffizienz des Antriebs.
Ende Juli 2025 wird Incat Tasmania von der dänischen Fährgesellschaft Molslinjen A/S mit dem Bau von zwei weiteren batterieelektrischen Hochgeschwindigkeits-Katamaranfähren beauftragt, für die ebenfalls Wärtsilä das vollständig integrierte Antriebssystem liefern wird, einschließlich der Batterien mit einer Kapazität von etwa 45 MWh. Die Übergabe der Ausrüstung an die Werft ist für das Folgejahr geplant.

Mit einer Länge von 129 m und einer Breite von 30,5 m werden die Schiffe jeweils Platz für bis zu 1.483 Passagiere und 500 Autos bieten. Nach ihrem Bau sollen sie auf der Kattegat-Route zwischen Jütland und Seeland eingesetzt werden. Die Auslieferung des ersten Katamarans ist für Ende 2027 geplant, der zweite soll 2028 folgen.
Darüber hinaus wird Mitte Juni 2025 nach einer fast dreiwöchigen Reise von der Cemre-Werft in der Türkei nach Kalundborg die vom dänischen Ingenieurbüro OSK-ShipTech entworfene Nerthus in Betrieb genommen, als erste von zwei 117 m langen, von der dänischen Fährgesellschaft Molslinjen A/S im Jahr 2022 in Auftrag gegebenen Doppelend-Elektrofähren, die nun die stark frequentierte Sommerroute zwischen Kalundborg und Ballen auf Samsø bedient.

von Hull 096
An Bord befindet sich ein von Echandia entwickeltes und geliefertes Lithium-Titanat-Oxid (LTO)-Batteriesystem mit 3,1 MWh und einer erwarteten Lebensdauer von mehr als zwölf Jahren, das speziell für den harten täglichen Fährbetrieb konzipiert ist. Das Schiff ist mit vier steuerbaren Strahlrudern ausgestattet, die von Elektromotoren angetrieben werden, sowie mit vier Notstromgeneratoren mit einer Leistung von jeweils 493 kW, die mit Pflanzenöl betrieben werden.
Im Oktober folgt die Meldung, daß Incat Tasmania damit begonnen hat, den ersten von vier Batterieräumen auf der künftig größten vollelektrischen Fähre der Welt mit Strom zu versorgen, bevor später in diesem Jahr die Probefahrten beginnen. Jeder der vier Batterieräume von Hull 096 beherbergt einen Teil der 5.016 Batterieeinheiten, die auf dem Schiff installiert werden. Nach der Fertigstellung wird das Schiff insgesamt etwa 250 Tonnen Batterien mit einer installierten Kapazität von 40 MWh an Bord haben, welche das Schiff 90 Minuten lang in Betrieb halten werden. An den Liegeplätzen des Schiffes in Argentinien und Uruguay werden Ladegeräte installiert, wobei eine vollständige Aufladung 40 Minuten dauern soll.
Die Hull 096 wird erstmals Mitte Dezember bei einem Testlauf auf dem Fluß Derwent zu 100 % mit Akkustrom betrieben, was als Weltpremiere in der batterieelektrischen Schiffahrt betrachtet wird. Das Schiff wird in den kommenden Monaten nach Südamerika auslaufen, um dort seinen Dienst aufzunehmen. Nur wenige Tage zuvor hat Incat einen Vertrag über den Bau einer dritten batteriebetriebenen Hochgeschwindigkeitsfähre für die Molslinjen unterzeichnet.
Es ist sinnvoll, an dieser Stelle auch die anderen umgerüsteten und neuen Elektro- und Hybridfähren aufzuführen, die in diesen Jahren zunehmend zum Einsatz kommen, denn dies geschieht nicht nur in Dänemark - und auch mit abweichenden elektrischen Antriebstechnologien. Gestartet wird mit Norwegen, wo der Einsatz von Elektroschiffen besonders sinnvoll ist, denn das Land erzeugt seinen Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen.
Bereits im September 2013 wird hier Skandinaviens
erste elektrische Kabelfähre mit einem vollelektrischen
Antriebssystem in Betrieb genommen, das von dem kanadischen Batterien-Hersteller
Electrovayat Inc. gemeinsam mit der Solund Verft AS, Maritime Engineering
AS Knarvik, HAFS Elektro & Rør AS und Electrovayas Tochtergesellschaft
Miljobil Grenland AS entwickelt und gebaut wurde. Auftragnehmer des
Projekts ist die Firma Magne Hope AS, die Gesamtkosten
einschließlich der Baukosten für die Rampen belaufen sich auf 20 Mio.
NOK.

Der Antrieb der KF Hisarøy basiert auf quer über die Meerenge gespannten Stahlseilen, je einer elektrisch-hydraulischen Winde auf jeder Seite des Schiffes, die mit Elektromotoren mit je 325 PS Leistung ausgestattet sind, sowie dem Prototyp eines 100 kWh Lithium-Ionen-Batteriesystems, das nachts im Hafen wieder aufgeladen wird.
Die 35 m lange und 8,6 m breite Fähre des Eigners Wergeland Halsvik AS (o. Wergelandsgruppa) und des Betreibers Gulen Skyssbåtservice, die 49 Passagiere sowie 6 Pkw oder einen 12,4 m langen Lkw mit einem Gesamtgewicht von 32 Tonnen aufnehmen kann, verkehrt nun täglich 8 - 10 Mal auf der ca. 750 m langen Strecke zwischen dem Ort Mjånes und der Insel Hisarøyna, für die sie etwa acht Minuten braucht. Die KF Hisarøy absolviert im Laufe ihres ersten Betriebsjahres mehr als 4.000 Fahrten ohne jegliche Zwischenfälle.
Wergeland betreibt auch die kleinste Elektroseilfähre Norwegens. Die Fjoneferja (o. Masfjord cable ferry – Fjon-M) in Nissdal führt über den Fjonesundet zwischen Fjone und Framnes, eine 500 m breite Meerenge im Nisser See. Die Fähre verbindet die Ost- und Westseite des Nissers und bietet Platz für drei Autos oder einen Lkw/Bus. Eigentümerin der Fähre ist die Gemeinde Nissedal, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme ließ sich bislang nicht finden.
Als die „weltweit erste Elektrofähre im Linienverkehr“,
die „weltweit erste batterieelektrische Auto- und Passagierfähre“ bzw.
die „weltweit erste Fähre, die ausschließlich mit Batteriestrom
betrieben wird“, wird die Autofähre bezeichnet, die die norwegische
Werft Fjellstrand AS zusammen mit der deutschen Siemens
AG entworfen und gebaut hat, und die im September 2014 auf
der Messe Shipbuilding, Machinery & Marine Technology (SMM)
in Hamburg die prestigeträchtige Auszeichnung Schiff des Jahres der
norwegischen Fachzeitschrift Skipsrevyen erhält.

(Grafik)
Die ZeroCat 120 wurde ursprünglich als Beitrag zu einem Wettbewerb des norwegischen Verkehrsministeriums im Jahr 2010 entwickelt, bei dem der Gewinner eine 10-Jahres-Lizenz für den Betrieb der Strecke Lavik - Oppedal bis 2025 erhält. Die eigentliche Bestellung der Fähre durch die Reederei Norled erfolgte dann im November 2012, die Kiellegung im Mai 2013 und der Stapellauf im April 2014.
Die 80 m lange und knapp 21 m breite Fähre mit einer Kapazität für 120 Autos und 360 Passagiere, die mit etwa 10 Knoten fährt, verfügt über einen leichten und schlanken Katamaran-Rumpf aus korrosionsfreiem Aluminium - was im Vergleich zu konventionellen Fähren halbes Gewicht und doppelte Lebensdauer bedeutet - und besitzt das elektrische Antriebssystem BlueDrive PlusC mit zwei 450 kW Motoren und einem 1 MWh Lithium-Ionen-Batteriepaket von Siemens, das zehn Tonnen wiegt. Das hocheffiziente Azipull-Antriebs- und Steuerungssystem stammt von Rolls-Royce. Darüber hinaus sind alle Systeme auf niedrigen Energieverbrauch und Wärmerückgewinnung optimiert, mit LED-Beleuchtung und PV-Paneelen.
Ab Mitte Februar 2015 verbindet die ZeroCat 120 - nun unter dem neuen Namen Ampere - die Ufer des Sognefjords, wobei die 5,7 weite Strecke zwischen den Orten Lavik und Oppdal an 365 Tagen im Jahr mit 34 Überfahrten pro Tag bedient wird. Die einzelne Überfahrt dauert 20 Minuten und erfordert 150 kWh, wobei an jedem Ende zehn Minuten für das Aufladen mit 1 MW beim Be- und Entladen vorgesehen sind.

Bedingt durch das relativ schwache Stromnetz in der Region, das nur darauf ausgelegt ist, kleine Dörfer zu versorgen, werden drei Batteriepakete eingesetzt: eines an Bord und jeweils eines als Zwischenspeicher in jedem Hafen. Diese 260 kWh Einheiten versorgen die Fähre während der Wartezeit mit Elektrizität. Besonders positiv: Der Strom in dieser Gegend kommt komplett aus Wasserkraftwerken. Die Elektro-Fähre Ampere wird 2016 mit dem GreenTec Award in der Kategorie Reise ausgezeichnet.
Nach zehn Jahren in Betrieb meldet der Fährbetreiber Norled, daß die Ampere den Sognefjord derweil mehr als 124.000 Mal überquert und dabei eine Strecke zurückgelegt habe, die einer 17-maligen Umrundung des Äquators allein mit Batterien entspricht, die übrigens von Corvus Energy stammen. Im Vergleich zu einer herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fähre konnten die Emissionen um 95 % und die Betriebskosten um 80 % (andere Quellen: bis zu 90 %) gesenkt werden, was zu Gesamteinsparungen von fast 15 Mio. $ führte.
Mit der kürzlich erfolgten Installation zusätzlicher Batterien zur Verlängerung der Lebensdauer des Schiffes wird die Ampere so lange weiterfahren, bis die nächste bahnbrechende Innovation zur Verfügung steht: Ab 2026 sollen vier autonome Fähren die Strecke befahren - dazu mehr in einem späteren Schwerpunkt.
Ebenso wichtig ist die Geschichte der 85 m langen Norled-Fähre Folgefonn,
die Mitte 1998 auf der Verbindung über den Fusafjord
zwischen Hatvik und Venjaneset in Dienst gestellt wird. Die mit einem
dieselelektrischen Antrieb gebaute Fähre mit einer Kapazität von 200
Passagieren und 76 Pkw wird 2014 auf Hybridantrieb
umgebaut, indem zur Versorgung der Antriebsmotoren und des Bordnetzes
Akkus mit einer Kapazität von 1 MWh installiert werden, die am Anleger
in Jektavik aufgeladen werden.
Im Jahr 2017 wird die Fähre für vollelektrischen Betrieb umgerüstet. Hierzu wird der Anleger mit einem Vakuum-Festmachersystem ausgestattet, in das ein System zum induktiven Laden der Akkumulatoren integriert ist. Das Schiff erhält im Wesentlichen eine Strom aufnehmende Platte auf der Außenhaut des Rumpfes, die mit der Batterie durch Kabel verbunden ist. Der Ladevorgang startet automatisch, sobald diese Platte im Hafen ihrem örtlichen, in die Kaimauer eingebauten Gegenstück auf wenigstens 50 cm nahekommt.

Folgefonn
Das berührungslose Ladesystem des finnischen Schiffs- und Energiekonzerns Wärtsilä Marine beschleunigt das Ladetempo um bis zu 20 %, arbeitet verschleißfrei und funktioniert auch bei Eis und Schnee ohne Einschränkungen. Die Anpassung des Wärtsila-Übertragungssystems an die Erfordernisse des Fährschiffsbetriebs wird von dem staatlichen norwegischen Entwicklungsfonds Innovation Norway mitfinanziert. Damit wird die Folgefonn zur weltweit ersten Fähre, die ein System zum drahtlosen Laden besitzt. Ab Juni 2022 verkehrt sie über den Vågsfjord zwischen Stangnes und Sørrollnes.
Auf dem Nordic EV Summit in Oslo im Februar 2018 berichtet Norled, daß die vollelektrische Fähre den Schadstoffausstoß um 95 % und die Kosten um 80 % im Vergleich zu benzinbetriebenen Fähren reduziert hat - was neue Kunden anlockt. Die Norled, die zu den großen Fährgesellschaften in Norwegen zählt, betreibt übrigens 45 Autofähren, 17 Schnellfähren für den Personenverkehr und einen Wasserbus für touristische Zwecke.
Im Juli erteilt die Norled dem polnischen Unternehmen Remontowa Shipbuilding den Auftrag für zwei diesel-elektrische Doppelendfähren, die nach der Auslieferung im vierten Quartal des Folgejahres auf der Verbindung Festøya-Solavågen in der Nähe von Ålesund in Norwegen zum Einsatz kommen sollen. Die 114,4 m langen und 17,7 breiten Fähren, die bis zu 120 Pkw und 296 Passagiere befördern können, beziehen im Normalbetrieb die gesamte benötigte Energie aus zwei an Bord installierten Batteriepaketen, während die Stromaggregate, mit denen die Schiffe ausgestattet sein werden, nur im Notfall eingesetzt werden sollen.

Sembcorp Marine
(Grafik)
Im Oktober werden darüber hinaus bei der singapurischen Werft Sembcorp Marine drei Plug-in-Hybrid-RoPax-Fähren bestellt. Die Schiffe werden von der LMG Marin gebaut, einer Tochtergesellschaft der Gruppe, und sollen im vierten Quartal 2020 ausgeliefert werden. Die 84,2 m langen Doppelstockfähren können jeweils bis zu 300 Passagiere sowie 80 Autos oder eine Kombination aus zehn Autos und zehn Sattelschleppern befördern. Das Trio ist für die Kurzstreckenverbindung Hella - Vangsnes - Dragsvik in Norwegen bestimmt.
Die Schiffe werden mit Lithium-Ionen-Batterieantrieb bei einer Betriebsgeschwindigkeit von 10 Knoten betrieben, bei Bedarf aber auch mit einem kombinierten Batterie/Diesel-Hybridsystem. Zu den energieeffizienten Lösungen, die auf den Fähren installiert werden sollen, gehören auch Schnelladestecker für die Landstromversorgung, Auto-Mooring, Auto-Crossing sowie effiziente Rumpf-, Antriebs- und Wärmerückgewinnungssysteme.

Um noch kurz in Norwegen zu bleiben: Hier ist ab Anfang Oktober 2015 auch
der weltweit erste elektrische Fischkutter unterwegs:
Das Fischerboot Karoline fährt vom norwegischen
Tromsø aus zur See – mit einem batteriebetriebenen Elektromotor.
Entwickelt hat den Elektro-Fischkutter der Bootshersteller Selfa Arctic AS, die elektrische Antriebstechnik stammt von Siemens. Die Akkus werden über Nacht im Hafen über das örtliche Stromnetz wieder aufgeladen. Zur Sicherheit sind zusätzlich auch ein Dieselmotor und ein Generator zur Stromerzeugung mit an Bord, die an langen Tagen auf See unterstützend eingreifen.

Im April 2016 erhält die ABB den Auftrag, das Stromversorgungssystem
für eine fast 70 m lange und 14,2 m breite Hybrid-Autofähre zu liefern,
die eine Passagierroute in Norwegen bedient. Die von Multi
Maritime entworfene Fähre MM63 (o.
MM 63 FC) wird von der Fiskarstrand Verft AS in Westnorwegen
gebaut und hat eine Kapazität von 60 Autos, davon zehn auf einem hebbaren
Deck, und 250 Passagieren.
Das Stromversorgungssystem von ABB ist Teil des gesamten elektrischen Systems, das von Acel geliefert wird. Kern des ABB-Lieferumfangs ist das Onboard-DC-Grid- Energieverteilungssystem, eine modulare elektrische Systemplattform, die Gleichstrom nutzt, um Energiequellen mit Verbrauchern zu verbinden. Dies vereinfacht die Integration von Energiespeichern erheblich, in diesem Fall zwei 270 kWh Batteriepaketen, und ermöglicht einen effizienteren Betrieb von Motoren mit variabler Drehzahl, was zu erheblichen Energie- und Emissionseinsparungen beiträgt. Der Eigner Torghatten Trafikkselskap AS hat zudem die Möglichkeit, weitere 16 Batteriesätze und einen Landanschluß zu installieren, um das Schiff zukünftig vollständig elektrisch zu betreiben.
Die MM63 wird mit dem Shippax environmental stewardship award 2017 für die weltweit erste mit Biodiesel betriebene Plug-in-Hybridfähre ausgezeichnet.
Im Mai 2016 nimmt die Plug-in-Hybrid-Fähre Vision
of the Fjords den regulären Fahrgastbetrieb auf der Strecke
Flåm – Gudvangen im UNESCO-Weltnaturerbe Nærøyfjord auf. Betreiber
ist die Reederei The Fjords, ein Tochterunternehmen
von Fjord1 (s.u.) und Flåm AS. Die Katamaran-Fähre wurde von der norwegischen
Werft Brødrene Aa gebaut und ist die erste der sogenannten
Seasight-Klasse, einer Reihe von Passagierschiffen mit Leichtbau-Rümpfen
aus Kohlefaserverbundwerkstoffen.

of the Fjords
Die 40 m lange und 15 m breite Fähre mit einer Kapazität von 400 Passagieren besitzt einen Hybridantrieb von ABB mit zwei Dieselmotoren von je 749 kW und zwei Elektromotoren mit je 150 kW sowie eine 600 kWh Batterie, die rund drei Stunden emissionsfreie Fahrt bei Stillstand der Dieselgeneratoren ermöglicht und ansonsten unterwegs von den Generatoren und im Hafen durch Landstrom aufgeladen wird. Das Schiff fährt mit bis zu 16 Knoten (29,6 km/h) und absolviert jährlich 700 Fahrten.
Große Panoramafenster und offene Decks, die die im Zickzack verlaufenden Bergpfade widerspiegeln, die man von ihren Decks aus sehen kann, bieten den Passagieren ein besonderes Naturerlebnis mit guter Sicht und geringem Geräuschpegel. Die Fähre wird mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Schiff des Jahres 2016.
Nur zwei Jahre später folgt das ebenfalls von der Brødrene Aa gebaute vollelektrische Schwesterschiff Future of the Fjords mit einer Länge von 42 m und einer Breite von 15 m, das ebenfalls eine Kapazität von rund 400 Passagieren hat.

of The Fjords
Der Antrieb in Form von zwei Elektromotoren mit jeweils 450 kW Leistung wird von einer 1,8 MWh Batterie versorgt und bringt das Schiff emissionsfrei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 16 Knoten. Die E-Fähre, deren Bau umgerechnet ca. 14 Mio. € gekostet hat, wird auf der SMM in Hamburg als Schiff des Jahres 2018 ausgezeichnet.
Die Aufladung erfolgt über eine Power Dock genannte, 40 m lange und 5 m breite schwimmende Schnelladeeinrichtung aus Glasfasern an der Anlegestelle Gudvangen, auf der ein 2,4 MWh Akku installiert ist, der die Akkus der Schiffe innerhalb von ca. 20 Minuten mit Energie für die nächste Fahrt versorgt.
Mitte 2020 kommt als drittes Elektroschiff die Legacy of The Fjords hinzu, mit gleichem Aussehen und ähnlichen technischen Spezifikationen. Zu den Neuerungen gehört, daß das Schiff auf beiden Seiten beladen werden kann und die Passagiere entweder an der Backbord- oder an der Steuerbordseite ein- oder aussteigen können.
Im Februar 2017 schließt die Color Line,
die sich als die größte Reederei Norwegens bezeichnet, einen Vertrag
mit dem norwegischen Schiffahrtskonzern Ulstein Verft über
den Bau des größten Plug-in-Hybridschiffs der Welt. Die von der Fosen-Werft
entworfene, 160 m lange und 27,1 m breite Fähre soll bis zur Herbstsaison 2019 fertiggestellt
sein, um dann auf der Strecke Sandefjord - Strömstad eingesetzt zu
werden.

Das Schiff mit dem Namen Color Hybrid wird 2.000 Passagiere und 500 Autos aufnehmen können. Es soll auf dem Weg von und nach der Stadt Sandefjord ausschließlich mit Batteriestrom betrieben werden. Die ca. 5 MWh Akkus liefern bis zu 60 Minuten Manövrieren und Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 12 Knoten. Color Line hat bereits einen Landstromanschluß in Oslo, Larvik und Kristiansand installiert, und mit dem entsprechenden Anschluß in Sandefjord werden alle norwegischen Häfen des Unternehmens über einen Landstromanschluß verfügen.
Der Bau beginnt im Juli 2017, die Kiellegung in der polnischen Crist-Werft erfolgt im April 2018 und der Stapellauf des Rohbaus im Oktober. Nach der Ausrüstung auf der Ulstein Verft im norwegischen Ulsteinvik wird das Schiff im Juni 2019 in Betrieb genommen. Anderen Quellen zufolge wird das Schiff erst im August fertiggestellt, abgeliefert und getauft.
Das Schiff wird 2017 mit dem Next Generation Ship Award der norwegischen Fachmesse Nor-Shipping sowie 2019 von der norwegischen Fachzeitschrift Skipsrevyen als Schiff des Jahres ausgezeichnet.
An dieser Stelle soll angemerkt werden, daß Ulstein im Mai 2022 das Konzept für ein 149 m langes Schiff für Nachschub, Forschung und Rettung vorstellt, das mit einem Thorium-Schmelzsalzreaktor (MSR) betrieben wird und dementsprechend den Namen Thor trägt. Es ist auch dafür geeignet, die nächste Generation von elektrisch angetriebenen Kreuzfahrtschiffen aufzuladen, die mit großen Batteriebänken betrieben werden, und soll genug Strom für vier Expeditionskreuzfahrtschiffe gleichzeitig liefern können.
Da die Thor, die über Hubschrauberlandeplätze, Feuerlöschgeräte, Rettungsausleger, Arbeitsboote, Labors und einen Vortragssaal verfügt, diese künftigen Kreuzfahrtschiffe aufladen soll, arbeitet Ulstein auch an dem Sif genannten Konzept eines 100 m langen, batteriebetriebenen Schiffs der Eisklasse 1C mit 80 Passagieren und 80 Besatzungsmitgliedern.
Im Oktober 2016 wird berichtet, daß der Fährbetreiber Fjord1,
ein großes norwegisches Transportkonglomerat mit Sitz in Florø, das
75 Schiffe betreibt, einen Auftrag an Siemens für
zwei batteriebetriebene Elektrofähren erteilt hat, die gegenwärtig
noch mit Dieselmotoren betrieben werden. Beide Elektrofähren verfügen
über eine Kapazität von 120 Pkw, zwölf Lkw und 349 Passagieren.
Die Ausschreibung für die 2,4 km lange Fährroute zwischen Anda und Lote ist die erste Ausschreibung für Fährdienste, bei der aufgrund der neuen, strengeren Umweltauflagen der staatlichen norwegischen Straßenverwaltung emissionsfreie oder emissionsarme Fähren vorgeschrieben wurden. Der elektrifizierte Betrieb soll im Januar 2018 aufgenommen werden.

von Havyard
Im Juni 2017 erhält die norwegische Havyard Ship Technology (später: Tersan Havyard Leirvik, Teil der Havyard Group) einen Auftrag in Höhe von umgerechnet 117 Mio. $ von der Fjord1, die ebenfalls Teil der Havyard Group ist, um mit der Entwicklung und dem Bau von fünf neuen Elektrofähren zu beginnen. Die Schiffe werden von Havyard Design & Solutions (HDS) entworfen und sollen in der Werft von Havyard Ship Technology in Leirviki Sogn, Norwegen, gebaut werden.
Die Auslieferung der fünf 111 m langen Fähren, die jeweils Platz für 120 Autos bieten, ist für 2018 und 2019 geplant. Drei der Fähren vom Typ Havyard 936 – 120 PBE Electric Ferry (die Hadarøy, die Suløy und die Giskøy) werden auf der Strecke Hareid - Sulesund eingesetzt, während die beiden anderen (die Rovdehorn und die Skopphorn) die Strecke Magerholm - Sykkylven bedienen werden. Schon im Bau sind zudem drei ,Umweltfähren’ für Fjord1, die in Hordaland und Sør-Trøndelag in Betrieb gehen werden. Das Unternehmen will bis 2021 die Hälfte seiner Fähren-Flotte elektrifiziert haben.
Bei Havyard stehen Anfang 2018 bereits 13 elektrische Fähren im Auftragsbuch, die mit Antriebs- und Steuerungssystemen der Tochterfirma Norwegian Electric Systems (NES) ausgestattet werden. Havyard stellt auch Dieselfähren auf Elektrobetrieb um und baut zudem autonome Fähren. Über letztere Entwicklungen wird in einem späteren Schwerpunkt gesprochen. Darüber hinaus soll in drei Jahren die erste Fähre zum Einsatz kommen, die von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird.
Im März 2018 folgt ein weiterer Auftrag von Fjord 1 an die Havyard-Gruppe in Höhe von 82 Mio. € über den Bau von sieben zusätzlichen Elektrofähren, die Anfang 2020 in Hordaland und Møre og Romsdal in Betrieb genommen werden sollen. Fünf der Fähren werden in Leirvik (Norwegen) und zwei in Cemre (Türkei) hergestellt. Während die ersten fünf jeweils 50 Autos transportieren können, sind die beiden letzteren für den Transport von jeweils 80 Autos ausgelegt.

(Grafik)
Im Juni 2020 stellt HDS den Entwurf für ein 70 m langes Stadt- und Fjordrundfahrt-Konzeptschiff vor, das eine Kapazität von 600 - 800 Passagieren haben und mit 10 - 11 Knoten fahren wird. Das Projekt ist das Ergebnis der im Juli 2019 begonnenen Zusammenarbeit des Unternehmens mit der unabhängigen norwegischen Forschungsorganisation SINTEF sowie der gemeinsam durchgeführten Forschung im Forschungs- und Entwicklungszentrum SFI Smart Maritime.
Bei diesen Schiffen handelt es sich allerdings nicht direkt um Fähren, sondern eher um Zubringer - denn sie sollen großen Kreuzfahrtschiffen mit Verbrennungsmotoren außerhalb der norwegischen Welterbe-Gebiete und Städte begegnen, um deren Passagiere auf schwimmenden Knotenpunkten zu übernehmen und dann in die innersten Teile der Fjorde und in die Stadtzentren zu bringen.
Die Schiffe werden batteriebetriebe Antriebe haben, und die Knotenpunkte werden auch als Ladestationen für die Mini-Kreuzfahrtschiffe dienen. Neben dem nachhaltigen Antrieb konzentriert sich HDS auf das Erlebnis der Passagiere mit geräumigen Innen- und Außenbereichen, übergroßen Fenstern, um mehr von der Landschaft zu sehen, und einem Design, das Rollstuhlfahrern hilft, sich frei auf dem Schiff zu bewegen.
Auch die von der Fosen Namsos Sjø AS betriebenen zwei
Fähren zwischen Flakk und Rorvik an der Westküste Norwegens werden
mit Siemens-Antriebstechnik ausgestattet. Der Betrieb soll hier 2019 aufgenommen
werden.

der IPT Technology
Im Dezember 2019 stellt das deutsche Unternehmen IPT
Technology ein induktives Ladesystem zur drahtlosen Übertragung
von rund 100 kW Strom vor, das dem o.e. von Wärtsila ähnelt. Es ist
zum Laden einer Elektrofähre im Einsatz, die auf dem Fluß Glomma Teile
der südnorwegischen Stadt Fredrikstad miteinander verbindet. Die 15
m lange Fähre, die 50 Personen befördern kann, ist im Dauereinsatz:
Sechsmal in der Stunde überquert sie den Fluß, rund um die Uhr und
sieben Tage die Woche.
Bereits in der Konzeptphase für den Umstieg auf eine E-Fähre schieden lange Ladepausen aus, und bei vielen kurzen Ladestopps sind Ladekabel unpraktisch. Mit der aktuellen induktiven Lösung werden die Batterien der Fähre zwischengeladen, während die Passagiere ein- und aussteigen. Im Schnitt finden so bis zu 150 kurze Ladevorgänge pro Tag statt. Die Ladestopps dauern zwar jeweils nur durchschnittlich 112 Sekunden, womit gerade einmal 2 kWh pro Ladevorgang fließen. Wegen der Häufigkeit der Ladestopps reicht das aber aus, um den Ladestand der Batterie in der E-Fähre auf rund 72 % zu halten.

(Grafik)
Im April 2020 erhält Wärtsilä den Auftrag über die
Konstruktion und Ausrüstung zweier neuer emissionsfreier Doppelendfähren
für den norwegischen Betreiber Boreal Sjø, die bei
Holland Shipyards in den Niederlanden gebaut und im Herbst des Folgejahres
in Betrieb gehen sollen. Zusätzlich zum Design liefert Wärtsilä die
Strahlrudermotoren, Batterien, bordseitige und landseitige Batterieladegeräte,
Notstromgeneratoren und andere elektrische Systeme.
Eine der Fähren wird 30 m lang sein und zehn Autos sowie etwa 100 Passagiere befördern können, während die andere 50 m lang sein wird und 35 Autos nebst 149 Passagieren, einschließlich der Besatzung, befördern kann. Die Fähren werden die Strecken Launes - Kvellandstrand - Launes sowie Abelnes - Andabeløy - Abelnes bedienen.

(Montage)
Bereits im Januar war bekannt gegeben worden, daß Boreal Sjø im Rahmen der fortschreitenden Elektrifizierung des städtischen Nahverkehrs den Zuschlag für das im Mai 2019 ausgeschriebene Projekt ,Inner Oslofjord 2021’ erhalten habe, um ab November 2021 die Inselfähren im Inneren Oslofjord zu betreiben - und zwar bis 2034. Es ist das erste Mal, daß der Betreiber einen Vertrag mit einem öffentlichen Verkehrsunternehmen abschließt, in diesem Fall mit Ruter, der für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Behörde der Hauptstadt.
Zur Erfüllung des Vertrags werden fünf von Multi Maritime entworfene, batteriebetriebene Fähren gebaut, die im Sommer 2022 einsatzbereit sein sollen. Obwohl sie vollelektrisch betrieben werden, verfügen sie über eine Reserve Biodieselantrieb. Die Passagierfähren werden die bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten und stark befahrenen Strecken von der Anlegestelle am Osloer Rathaus zu den Inseln im Oslofjord bedienen.
Die Flotte wird ähnliche Betriebskosten haben wie die derzeitigen Schiffe, aber in der Herstellung teurer sein. Allerdings wird die Kapazität jedes der 35 m langen und 8 m breiten Schiffe 350 Personen betragen und damit deutlich mehr als die 236 Passagiere der Schiffe der jetzigen Flotte. Zudem gibt es zwei Decks mit großem Sonnendeck sowie einen gemütlichen Salon mit großen Glasflächen und guter Aussicht. Das Vorzeigeobjekt soll Oslo dem Ziel einen Schritt näherbringen, die erste emissionsfreie Stadt der Welt zu werden.
Im Jahr 2020 sind in Norwegen rund 200 öffentliche
Autofähren auf über 120 Routen im Einsatz, von denen bis 2022 etwa
70 teilweise oder vollständig elektrifiziert sein sollen. Daneben gibt
es ca. 600 Expreßboot-Linien und Schnellboote, die regelmäßig zwischen
Inseln und Küstenorten pendeln.
Die Fachpresse meldet im Februar 2021, daß das norwegische
Wasserstoff-Unternehmen TECO 2030 ASA, das aus der
Teco Maritime Group entstand, mit der niederländischen Werft Thecla
Bodewes Shipyards zusammenarbeitet, um Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe
für alle Arten von Flußschiffen wie Schubboote, Baggerschiffe, Passagier-
und Frachtschiffe sowie Flachbodenschiffe zu entwickeln.
Berichten vom Juli 2022 zufolge leitet die TECO 2030 zudem ein Konsortium mit den Partnern Umoe Mandal und Blom Maritime, das mit Hilfe von staatlichen Fördermitteln in Höhe von 500.000 € ein mit Wasserstoff betriebenes Hochgeschwindigkeitsschiff entwickeln will. Das H2-Schiff soll 200 - 300 Passagiere bei einer Geschwindigkeit von mehr als 35 Knoten (64,8 km/h) befördern und auf längeren Strecken eingesetzt werden. Bis Ende 2023 soll ein Hersteller ausgewählt werden, damit die Erprobung auf See 2025 beginnen kann.
Zu einer Realisierung kommt es allerdings nicht, denn die TECO 2030 meldet im Dezember 2024 Insolvenz an, da es ihr nicht gelingt, ausreichend Kapital für die Fortführung des Betriebs aufzubringen.

Im März 2021 wird die norwegische Elektroflotte um
die Bastø Electric erweitert, eine vollelektrische
Fähre, die entweder 200 Pkw oder 24 Lkw sowie 600 Passagiere befördern
kann. Das von der Sefine-Werft in der Türkei gebaute Schiff ist 139,2
m lang, 21 m breit und kann bis zu 13 Knoten (24 km/h) schnell fahren.
Es wird Norwegens verkehrsreichste Fährstrecke zwischen Horten und
Moss über den Oslofjord bedienen, die etwa 10,5 km lang ist.
Die Fähre verfügt über eine Batteriekapazität von 4,3 MWh und soll 20 - 24 Überfahrten pro Tag bewältigen, die sie dank eines von Kongsberg Maritime entwickelten Systems weitgehend autonom durchführen wird. Mehr über diese Technologie wird in einem späteren Schwerpunkt berichtet.
Zur gleichen Zeit wird gemeldet, daß bald die wasserstoffbetriebene
Fähre Hydra (o. MF Hydra) von Norled in
See stechen wird, deren Rumpf kürzlich von der Norse-Werft in der
Türkei in der norwegischen Werft Westcon Yards in Ølensvåg eingetroffen
und nun bereit für die Ausrüstung und Fertigstellung ist.

und Nesvik
Das 82,4 m lange und 16,75 m breite Schiff ist für 299 Passagiere, 80 Pkw und zehn Lkw ausgelegt. Es wird drei verschiedene Energiequellen nutzen können: Neben zwei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen von der kanadischen Firma Ballard Power Systems mit einer Leistung von jeweils 100 kW wird auch ein 1,36 MWh Batteriepaket installiert.
Die Brennstoffzellen werden kontinuierlich zum Aufladen der Batterien beitragen. Darüber hinaus können diese an den Fähranlegern in Hjelmeland und Nesvik, die auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords liegen, vollständig aufgeladen werden - und es gibt zwei Dieselgeneratoren mit je 440 kW als Backup.
Es wird erwartet, daß durchschnittlich 50 % der für den Betrieb der Hydra benötigten Energie aus dem mitgeführten flüssigen Wasserstoff erzeugt werden. Über dieses und andere Schiffe, die primär auf Wasserstoff basieren, wird ausführlich in dem entsprechenden Kapitel berichtet (in Arbeit).
Auf der Abbildung ist neben der als „weltweit erste Brennstoffzellen-Fähre“ bezeichneten Hydra auch ihr Schwesterschiff zu sehen, die vollelektrische Fähre Nesvik, die später für den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden kann. Die Hydra wird in diesem Jahr zudem als Schiff des Jahres ausgezeichnet.
Die Fähre kommt im Sommer 2021 in Ryfylke, östlich von Stavanger, zum Einsatz und ist zunächst nur im Batteriebetrieb unterwegs. Der Einbau der zwei Brennstoffzellen und des 80.000-Liter-Tanks für flüssigen Wasserstoff ist im Winter vorgesehen, so daß ab dem Frühjahr 2022 der kombinierte Betrieb aus Batterien und Brennstoffzellen möglich wird. Dadurch kann die Fähre täglich 19 Stunden lang die Häfen Hjelmeland, Skipavik und Nesvik bedienen, wobei sie eine Strecke von 260 km zurücklegt, was mit Batterien alleine nicht zu schaffen wäre.
Die Brennstoffzellen-Fähre wird im Rahmen des Projekts FLAGSHIPS von der EU mitfinanziert. Dem FLAGSHIPS-Konsortium gehören zwölf europäische Partner an, darunter aus Norwegen Norled, SEAM, Maritime CleanTech sowie LMG Marin. Das Projekt beinhaltet außerdem den Bau eines Schubschiffs namens H2 Barge 2, das mit zwei 100 kW Brennstoffzellen ausgestattet ab Februar 2024 auf der Rhône und ein kurzes Stück im Mittelmeer zwischen Marseille und Lyon pendelt - sowie eines kommerziellen Frachtschiffes, das unter dem Namen Zulu 06 Ende 2024 in Paris offiziell vom Stapel gelassen wird.
Im September 2022 erhält die Medstraum als „die erste vollelektrische Schnellfähre der Welt“ die Auszeichnung Schiff des Jahres, mit der die Fachzeitschrift Skipsrevyen seit 1997 den norwegischen Schiffbau und das norwegische Design von Weltklasse würdigt. Wie schon zuvor wird die Auszeichnung auf der SMM in Hamburg verliehen.

Die batteriebetriebene Fähre für 147 Passagiere, die von der traditionsreichen Bootswerft Fjellstrand Verft AS entworfen und gebaut ist und die der Reederei Kolumbus AS gehört, verfügt über einen äußerst effizienten Katamaran-Rumpf und hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 23 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 27 Knoten. Das Energiespeichersystem von Corvus Energy hat eine Kapazität von gut 1,5 MWh und eine Landladeleistung von 2,3 MW. Die Batterie hält bei 23 Knoten eine Stunde lang.
Das Schiff ist aus Aluminium gebaut, um ein geringes Gewicht zu gewährleisten und am Ende der Lebensdauer vollständig recycelt werden zu können. Die Medstraum ist das erste Schiff, das aus dem Projekt TrAM (Transport: Advanced and Modular) hervorgegangen ist, das sich auf emissionsfreie Technologie, effizientes Design und Fertigungsmethoden konzentriert und das vom EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon2020 und dem Rogaland County Council finanziert und vom norwegischen Cluster Maritime CleanTech unterstützt wird.
Das neue Schiff nimmt im dritten Quartal den regulären Passagierverkehr zwischen der Stadt Stavanger und den umliegenden Gemeinden und Inseln auf, wobei Strom aus dem Stromnetz als einzige Energiequelle genutzt wird. Die Schnellfähre wird rund um die Uhr verkehren, eine Überfahrt dauert zwischen 35 und 40 Minuten.

(Grafik)
Im Februar 2023 unterzeichnet das norwegische Technologieunternehmen SEAM AS mit dem schwedischen Brennstoffzellen-Hersteller PowerCell AB einen Vertrag im Wert von 19,2 Mio. € über die Lieferung von Wasserstofflösungen für zwei norwegische Staatsfähren, die auf der längsten Fährverbindung des Landes den Vestfjord bei den Lofoten überqueren und dabei Strecken von bis zu vier Stunden zurücklegen. Laut PowerCell handelt es sich dabei um das bislang weltweit größte Wasserstoffprojekt in der Schiffahrtsindustrie.
Die norwegische Reederei Torghatten Nord wird die von der Norwegian Ship Design Co. (NSDC) entworfenen, 120 m langen Fähren liefern, die jeweils eine Kapazität von 599 Passagieren, 120 Pkw und zwölf Lkw haben, während PowerCell sein Marine System 200 installieren wird, das etwa 13 MW Leistung erzeugt. Für eine höhere elektrische Leistung lassen sich mehrere Systeme kombinieren.
Weitere Daten werden nicht genannt, außer daß die Fähren gemäß den Vorgaben der norwegischen Regierung mit mindestens 85 % Wasserstoff und höchstens 15 % Biokraftstoff betrieben werden müssen. Die Auslieferung soll im vierten Quartal 2024 erfolgen, der Einsatz der Fähren dann ab 2025. Tatsächlich erhält die Myklebust Verft den Auftrag der Torghatten Nord zum Bau der beiden Fähren aber erst im April 2024, so daß sie nun im Laufe des Jahres 2026 ausgeliefert werden sollen.
Mitte April 2025 kündigt die norwegische Regierung
an, daß kleine und große Touristenschiffe und Fähren ab Anfang 2026 (bzw.
ab Anfang 2032 für größere Schiffe) mit sauberem Strom
betrieben werden müssen. Darüber hinaus sind alle Fähren, die entlang
der norwegischen Küste verkehren, verpflichtet, bis 2030 auf
elektrischen Antrieb umzustellen.
Der norwegische Ausrüster Brunvoll Mar-El schließt im August 2025 einen Vertrag mit der Werft Oma Baatbyggeri über die Lieferung der elektrischen Antriebssysteme für eine emissionsfreie Katamaranfähre, die von der heimischen Bootsreiseagentur Rødne Fjord Cruise bestellt wurde, um eine Strecke zwischen Lauvik und Lysebotn im Bezirk Lysefjord im Südwesten Norwegens zu bedienen. Der Katamaran wird im Rahmen eines Vertrags mit der Kolumbus AS eingesetzt, einer öffentlichen Verkehrsverwaltung in Rogaland, wo der Lysefjorden liegt.

(Grafik)
Die Fähre, die 97 Passagiere und bis zu zwölf Fahrzeuge befördern kann, wird mit einem 2,7 MW Antriebssystem ausgestattet, das eine Geschwindigkeit von bis zu 18 Knoten ermöglichen soll. Sie soll im Juni 2026 übergeben werden.
Darüber hinaus waren im Januar bereits drei Schiffe mit der Technologie von Brunvoll im Rahmen eines 15-Jahres-Vertrags mit dem Vestland County Council in Betrieb genommen worden. Eigentümer der Schiffe ist die o.e. Fährgesellschaft Fjord1.
Daneben schließt Brunvoll einen Vertrag mit der Torghatten Nord über die Ausstattung einer neuen, 73,3 m langen Hybridfähre, die von der litauischen Werft Western Baltija Shipbuilding gebaut und mit Brunvolls Zug-Azimut-Thrustern, einem Auto-Crossing-System für automatisiertes Routenmanagement und einem ferngesteuerten Zustandsüberwachungssystem ausgerüstet werden wird. Die Fähre soll 2026 in Betrieb genommen werden.
Als Nächstes sollen die entsprechenden Entwicklungen in Schweden betrachtet werden. Hier verpflichtet sich im Jahr 2015 der Reederverband als einer der ersten Schiffahrtsverbände weltweit, den Seeverkehr bis 2050 kohlenstofffrei zu gestalten.
Gemäß einer im April 2014 erfolgten Ankündigung des
schwedischen Unternehmens Echandia Marine AB, eines
Entwicklers und Herstellers von Batterie- und Brennstoffzellensystemen,
bereitet der lokale Betreiber und Hersteller Green City Ferries (GCF)
- als Teil der Echandia - den Start der „weltweit ersten aufgeladenen
elektrischen Passagierfähre“ vor. Es wird erwartet, daß die Einfachheit
des elektrischen Antriebssystems die Betriebskosten im Vergleich zu
einer Dieselfähre um bis zu 30 % senken wird.

Bei der 23 m langen und 5,3 m breiten Movitz, die bis zu 100 Personen befördern kann, handelt es sich um eine konventionelle Passagierfähre, die viele Jahre mit Dieselantrieb im innerstädtischen Linienverkehr in Stockholm eingesetzt wurde und nun innerhalb von sechs Monaten auf Elektroantrieb umgerüstet wird. Dies geschieht mit zwei 125 kW (andere Quellen: 140 kW) starken POD-Motoren, die von Nickel-Metall-Hydrid-Batterien mit einer Kapazität von 180 kWh angetrieben werden. Damit kann das Schiff bis zu einer Stunde zwischen den Ladevorgängen betrieben werden.
Anderen Quellen zufolge wird das Schiff mit 180 kWh Lithium-Titanat-Oxid-Batterien (LTO) von Toshiba betrieben, die nach einem 10-minütigen Supercharging eine komplette Stunde emissionsfreie Fahrt ermöglichen. Diese Art von Nutzungszyklus macht große, teure und schwere Batteriepakete überflüssig, und die Schnelladung an den Anlegestellen eignet sich sehr gut für den Einsatz von Kurzstreckenfähren, wie bei der 7,5 km langen Strecke, welche die Movitz zurücklegt, die ab August in der Stockholmer Innenstadt auf der Pendlerlinie zwischen Klara Mälarstrand, Lilla Essingen, Solna Strand und Gamla Stan verkehrt.
Im Mai 2016 läuft bei Latitude Yachts in Riga, Lettland, eine besondere Elektrofähre vom Stapel, deren von SES Europe AS koordinierte Entwicklung durch acht Partnerunternehmen bereits 2013 begann, als die schwedische Energiebehörde für ein 44 Monate laufendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt Gelder in Höhe von 1 Mio. € bereitstellte. Hinzu kommen 2,2 Mio. € von der EU. Die Movitz wird in diesem Zusammenhang als ,Proof-of-Concept’ der Hybrid-Passagierfähre betrachtet, die kommerziell betrieben wurde.

Die Erstvorstellung der neuen vollelektrisch betriebenen Schnellfähre BB Green (Battery Boat Green, auch: AiriEl) durch die GCF erfolgt im Juni 2016 in Stockholm. Dabei handelt es sich um einen ca. 20 m langen, 6 m breiten und 25 Tonnen schweren Prototypen mit einer maximalen Kapazität von rund 70 Passagieren plus 20 Fahrrädern, mit dem anschließend auf innerstädtischen Wasserwegen Test- und Demonstrationsfahrten durchgeführt werden. Später wird die Elektrofähre für den Pendlerverkehr auch in anderen europäischen Städten vorgestellt und betrieben, wie z.B. in Göteborg und Oslo.
Diese erste Fassung verfügt über eine 200 kWh Lithium-Ionen-Batterie und zwei Elektromotoren mit je 280 kW Leistung. Die emissionsfreie Fähre erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten (55,5 km/h) und wird im Juni 2017 auf der Electric & Hybrid Marine World Expo Conference in Amsterdam mit dem Electric & Hybrid Marine Award ausgezeichnet.
Später wird eine verlängerte Version entwickelt, die BB Green 24, die bis zu 147 sitzende Passagiere befördern kann. Dieses 24,8 m lange und 7,5 m breite Serienmodell, das ein Gewicht von ca. 28 Tonnen hat, ist mit zwei 160 kW Elektromotoren sowie Propellergondeln von Volvo Penta ausgestattet. Damit wird eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten erreicht (andere Quellen: 35 Knoten / 65 km/h), was das Schiff zum weltweit schnellsten seiner Art macht. Die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 26 Knoten (48 km/h).

Die eigentliche Besonderheit dieser Elektrofähre besteht in ihrem Luftkissen-Rumpf aus Carbon-Verbundbauweise, den die norwegische Firma Effect Ships International AS (ESI) hergestellt hat. Dieses luftunterstützte Wasserfahrzeug-Design (Air-Supported Vessel, ASV) ist eine Weiterentwicklung der bekannten Luftkissenfahrzeuge durch die SES Europe, die auch ein Patent darauf besitzt, in welchem als Erfinder ein Arne Osmundsvaag genannt wird (US-Nr. 6.672.234, beantragt 2002, erteilt 2004). Das Design reduziert den Wasserwiderstand und den Energieverbrauch um bis zu 40 % und begrenzt die Wellenbildung auf max. 16 cm.
Dies wird erreicht, indem ein Gebläse Druckluft unter das Schiff bläst, um dort einen Hohlraum zu schaffen. Das Verdichten und Einblasen von 15 m3 Luft pro Sekunde (bei einem Druck von 4,5 kPa) geschieht durch einen einzigen Auslaß in den Spalt unter dem Schiffsrumpf.
Das luftgekühlte Energiespeichersystem, das von dem Schweizer Hersteller Leclanché stammt (s.u.), besteht aus einer 500 kWh Lithium-Titanat-Oxid (LTO) Batterie mit einer Dauerleistung von rund 650 kW, die sowohl den Hauptantrieb als auch das Auftriebsventilatorsystem antreibt, d.h. das im Bug untergebrachte 60 kW Luftkissengebläse (andere Quellen: 80 kW). Die Batterie ist mit bis zu 2 MW schnelladefähig, wodurch eine Vollaufladung in 15 - 20 Minuten möglich wird. Die Reichweite der BB Green 24 beträgt 26 km (andere Quellen: bis zu 30 km) und der Verbrauch wird mit rund 25 kWh pro Seemeile bei 26 Knoten Geschwindigkeit angegeben. Das Schiff kann 30 Minuten lang eine hohe Geschwindigkeit beibehalten.
Nach Fertigstellung des ersten Produktionsschiffs arbeiten die Ingenieure des Unternehmens an der Integration und Erprobung von Aufdach-Solarpaneelen auf der Fähre, von denen sie sich einen passiven Energiezuwachs von etwa 5 % erhoffen. Darüber hinaus plant Echandia die Entwicklung eines maritimen Brennstoffzellensystems, das für größere und längere Fahrten eingesetzt werden könnte. Eine geplante Route führt z.B. über 90 Seemeilen und könnte ein Schiff mit 300 Fahrgästen umfassen. Die Produktion der BB Green 24 ist zwar serienreif, doch lassen sich bislang keine Verkäufe belegen.
Was die erwähnte AirCoating-Technologie betrifft,
bei der Luft unter das Schiff geblasen wird, um den Wasserwiderstand
zu reduzieren - und die uns weiter unten auch bei dem französischen NepShuttle begegnen
wird -, so startet im Mai 2018 das über drei Jahre
laufende und von der Europäischen Kommission mit 5,3 Mio. € unterstützte
Projekt Air Induced friction Reducing ship COATing (AirCoat),
an dem neben dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
und der Universität Bonn acht weitere Forschungsgruppen
beteiligt sind, darunter Wissenschaftler aus Belgien, den Niederlanden,
Zypern und Malta. Als Projektkoordinator fungiert das Fraunhofer-Center
für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML in Hamburg.

Schiffe, deren Bauch von Luft umströmt wird, haben nicht nur einen geringeren Widerstand gegen Wasser, gleiten besser dahin und verbrauchen weniger Treibstoff, auch die Abstrahlung von Schall reduziert sich und das Fouling, d.h. die Besiedelung mit Meeresorganismen, wird verhindert. Eine Methode, um stählerne Flächen dauerhaft und ohne ständigen Energieaufwand mit einer hauchdünnen Luftschicht zu umhüllen, finden die Professoren Thomas Schimmel vom KIT, Wilhelm Barthlott von der Universität Bonn und Alfred Leder von der Universität Rostock, die seit vielen Jahren den Salvinia-Effekt untersuchen, der an Schwimmfarnen (Salvinia molesta) beobachtet werden kann.
Deren Oberfläche ist extrem wasserabweisend, außerdem ist sie mit feinsten Haaren bedeckt, die in ihrer Form an kleine Schneebesen erinnern und durch eine besondere chemische Heterogenität charakterisiert sind. Die Einzelhaare sind einerseits wasserabstoßend, jedoch besitzt jedes einzelne Härchen noch eine wasseranziehende Spitze, die wie ein Klebepunkt am Wasser haftet und damit die eingeschlossene Luftschicht dauerhaft stabilisiert.
Um diesen Effekt technisch nutzbar zu machen, entwickeln die Forscher eine Methode zur Herstellung einer künstlichen Oberfläche, die den Effekt im Labor nachahmt. Ein Prototyp, der vor mehr als fünf Jahren unter Wasser gesetzt wurde, ist immer noch mit einer dauerhaften Luftschicht bedeckt. Die selbstklebende Folie ist allerdings nicht den rauhen Bedingungen einer Fahrt auf hoher See ausgesetzt.
Eine technische Folie muß dagegen dauerhaft kleben und ihre Anziehungskraft für Luft nicht einbüßen. Hier gibt es noch erheblichen Optimierungsbedarf, bevor die Effizienz und industrielle Machbarkeit im Labor, auf Forschungsschiffen und letztlich auf Containerschiffen demonstriert werden könnnen. Wie viel die passive Luftschmiertechnologie tatsächlich einspart und wie stark die Umwelt entlastet wird, läßt sich heute noch nicht sagen. Das werden die Versuche im normalen Schiffsbetrieb ergeben.
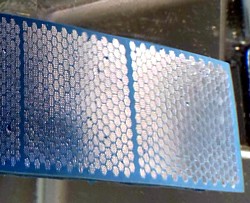
Luftträger
Im Dezember 2018 veröffentlicht Barthlott gemeinsam mit weiteren Kollegen die im Netz einsehbare Studie ,Bionics and green technology in maritime shipping: an assessment of the effect of Salvinia air-layer hull coatings for drag and fuel reduction’, in welcher sie zu dem Schluß kommen, daß sich mit dem Beschichten der Schiffsrümpfe bis zu 1 % der weltweiten CO2-Emission vermeiden ließe, indem die Schiffe bis zu 20 % an Kraftstoff einsparen.
Diese Arbeit entsteht im Zuge des Forschungsvorhabens Air-Retaining Surfaces (ARES), bei dem das KIT mit den Universitäten Bonn und Rostock kooperiert. Auf der Abbildung ist ein metallischer Träger zu sehen, dessen blaue Farbe von der silbern reflektierenden Luft verdeckt wird.
ARES wird im März 2019 für die Erforschung und Entwicklung künstlicher, luftspeichernder Oberflächen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Validierungspreis ausgezeichnet. Außerdem entsteht aus dem KIT die Ausgründung ACT Aircoating Technologies GmbH, um die neue Technologie in den Markt einzuführen.
Innerhalb des EU-Forschungsprojekts Green Fast Ferries (GFF)
wird 2017/2018 ein neues, speziell
für den maritimen Einsatz konzipiertes Lithium-Titanat-Oxid (LTO)-Batteriesystem
entwickelt, das sich besonders durch kurze Ladezeiten und hohe Sicherheit
auszeichnet. Im Jahr 2019 folgt die Gründung der offiziellen
Gesellschaft Green City Ferries AB durch Hans und Fredrik
Thornell, die auch schon früher im Projekt involviert waren.

(Grafik)
Außerdem beginnt gemeinsam mit der Echandia, dem neuseeländischen Katamaranentwickler Teknicraft und dem italienischen Yachtdesigner Studio Sculli die Entwicklung der modernen Serienfähre Beluga24, einem 24,8 m langen, aus Kohlefaser gefertigten Katamaran, der durch Elektro- oder Wasserstoffantrieb einen emissionsfreien Betrieb ermöglicht. Die leichte Pendlerfähre ist für hohe Geschwindigkeiten, geringe Wellenbildung und eine komfortable Fahrt für bis zu 150 Passagiere nebst 28 Fahrrädern konzipiert. Sie soll zudem mittschiffs mit einer Tragfläche ausgestattet werden, die sie aus dem Wasser hebt, um den Luftwiderstand zu verringern und die Reichweite zu erhöhen.
Im Juni 2020 wird durch die GCF und ElectriCity der ,Båtplan Stockholm 2025’ offiziell bekanntgegeben, der eine Strategie für eine grüne Umstellung des gesamten dortigen Schiffsverkehrs beinhaltet.
Die Initiative ElectriCity war 2013 in Göteborg ins Leben gerufen worden, um innovative Elektromobilitätslösungen im urbanen Verkehr zu testen und zu etablieren. Die beteiligten Partner sind der Volvo-Konzern, die Region Västra Götaland, Västtrafik, die Stadt Göteborg, die Chalmers University of Technology, die schwedische Energieagentur, der Wissenschaftspark Johanneberg, der Wissenschaftspark Lindholmen, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Ericsson, Keolis, Akademiska Hus und Chalmersfastigheter. Die Umsetzungen begannen dann 2015 mit Elektrifizierungsprojekten im Busverkehr.

Der nun präsentierte Plan sieht vor, den Einwohnern von Göteborg bis 2025 einen emissionsarmen Fährdienst zu bieten, der auf batteriebetriebenen und wasserstoffbasierten Schnell- und Linienfähren basiert. Im Einzelnen geht es um die Inbetriebnahme von 23 neuen, schnellen Kohlefaserschiffen, die mit Strom und Wasserstoff betrieben werden, die Umrüstung von 27 bestehenden Schiffen auf Strom- oder Wasserstoffbetrieb und die Beibehaltung von 16 bestehenden Schiffen, die für den Spitzenbedarf eingesetzt werden sollen.
Im Rahmen von ElectriCity war bereits im Februar 2019 begonnen worden, die ursprünglich im Jahr 1994 in Dienst gestellte Fähre Älvsnabben 4 auf vollelektrischen Antrieb umzurüsten, was durch ein batterieelektrisches Antriebssystem von Volvo Penta geschieht. Der Umbau und die grundlegende Modernisierung erfolgen in den Jahren 2021 – 2022 in Zusammenarbeit mit dem Betreiber Styrsöbolaget, der im Auftrag des Verkehrsverbunds Västtrafik handelt, welcher für den öffentlichen Verkehr in Västra Götaland zuständig ist.
Die umgerüstete Älvsnabben 4 ist die erste Elektrofähre der Stadt, die längere Strecken mit mehreren Stopps auf dem Fluß zurücklegen kann und über eine Schnelladefunktion verfügt.
Im Oktober 2021 wird gemeldet, daß die GCF der Echandia den rund 14 Mio. SEK schweren Auftrag für den Hochgeschwindigkeitskatamaran mit integriertem Batterie- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem erteilt habe. Die Auslieferung wird im Herbst 2022 erwartet. Auf den veröffentlichten Grafiken ist auch eine große PV-Dachfläche zu sehen, über die es aber keine weiteren Angaben gibt.
Zwischen 2020 und 2023 werden zudem Fördergelder in Höhe von mehreren Millionen SEK aus Schweden und der EU akquiriert und Strukturen für die Serienproduktion errichtet.

Im Februar 2014 stellt der Stockholmer Fährbetreiber Ballerina sein erstes batteriebetriebenes Boot vor, das im Auftrag der Stockholmer Verkehrsbetriebe von der Faaborg Vaerft in Zusammenarbeit mit Principia North A/S und Wilhelmsen Technical Solution entwickelt, konstruiert und aus dem PVC-Hartschaum Divinycell H von DIAB gebaut wurde. Der Sandwich-Verbundwerkstoff, der aufgrund seiner Festigkeit, Geräuschdämmung und Isolationseigenschaften ein hervorragendes Material darstellt, wird hauptsächlich für den Rumpf, die Oberseite und das Steuerhaus verwendet.
Die neue, eisverstärkte Sjövägen ist mit einem Doppelpropellersystem, zwei 160 kW Elektromotoren für den Antrieb, einer 500 kWh Lithium-Ionen-Batteriebank des deutschen Herstellers Saft Batterien GmbH, einem elektrohydraulischen Steuersystem, einem elektrischen Bugstrahlruder sowie Kommunikations- und Navigationsausrüstung ausgestattet. Die Batterien werden während der Übernachtung der Fähre im Hafen vollständig und im Laufe des Tages zweimal teilweise aufgeladen.
Wenn die Elektrofähre im September ihren Betrieb aufnimmt, wird sie Fußgänger und Radfahrer zwischen zehn Haltestellen auf einer 50-minütigen Strecke auf den Wasserwegen von Stockholm befördern. Sie wird das ganze Jahr über in Betrieb sein und acht Rundfahrten pro Tag absolvieren. Das Schiff ist für den Betrieb mit zwei Personen ausgelegt und kann bis zu 150 Passagiere, 15 Fahrräder, sechs Rollstühle und acht Kinderwagen befördern.
Die Reederei Waxholmsbolaget, die sich im Besitz der Stadt Stockholm befindet und für den öffentlichen Seeverkehr im Stockholmer Schärengarten und im Stockholmer Hafen zuständig ist, nimmt im Januar 2019 ihre erste eisgängige Hybrid-Passagierfähre in Betrieb, die in Furusund stationiert ist und nun bis zu 150 Passagiere nebst Fracht von und zu den Inseln befördert, insbesondere im Norden. Zum Heben der Fracht ist auf dem Vorderdeck ein Kran angebracht.

Die 27,5 m lange Fähre namens Yxlan, die von Baltic Workboats in Estland entworfen und gebaut wurde, ist mit einem äußerst kompakten Hybrid-Elektroantriebssystem von Danfoss Editron Oy ausgestattet, das aus zwei Hybridantriebssträngen mit Elektromotoren und -Generatoren besteht. Es ist nur etwa halb so groß wie vergleichbare Systeme, was auf die kleinen, hocheffizienten und leichten 374 kW Elektromotoren zurückzuführen ist, die mit der Synchron-Reluktanz-Permanentmagnet-Technologie arbeiten.
Betrieben wird das Schiff mit zwei 405 kW Dieselmotoren und einer Batteriebank, die parallel zu den Dieselgeneratoren oder unabhängig davon für den Betrieb des Schiffes genutzt werden kann. Die Höchstgeschwindigkeit der Yxlan liegt bei über 12 Knoten, ihre Dienstgeschwindigkeit bei 10 - 11 Knoten.
Da die Fähre das ganze Jahr über in Betrieb ist, wurde sie speziell für den Einsatz mit einer Geschwindigkeit von 4 Knoten in bis zu 25 cm dickem Eis konzipiert. Sie kann mit nur zwei Besatzungsmitgliedern betrieben werden, und die beiden Rettungsinseln können ferngesteuert zu Wasser gelassen werden, wodurch ein hohes Sicherheitsniveau gewährleistet wird.
Um die Umweltbelastung und die Betriebskosten zu senken, ist das Schiff rundum hochwertig isoliert, kann die Abwärme der Motoren zurückgewinnen, wird mit direktem Seewasser oder mit Kältemaschinen gekühlt und verfügt über eine Wärme-/Kälterückgewinnung aus der Abluft.
Im Februar 2021 stellt die schwedische Reederei Stena Line einen ambitionierten Plan für die Route zwischen dem schwedischen Göteborg und dem dänischen Frederikshavn über das Kattegat vor, bei dem dort bis 2030 zwei etwa 200 m lange Batteriefähren ihren Dienst aufnehmen sollen. Unter dem Projektnamen Stena Elektra werden zwei fossilfrei betriebene Schiffe von ganz neuen Dimensionen entstehen. Ein konkreter Entwurf für die beiden Fähren soll bis Anfang 2022 vorgelegt werden, der Bau könnte dann 2025 beginnen.

(Grafik)
Die Reederei hatte bereits vor einigen Jahren angekündigt, den Verkehr auf der Route Schritt für Schritt auf Batterie-Betrieb umzustellen - und seit 2018 ist die Stena Jutlandica dort im Hybrid-Modus unterwegs. Dank elektrisch angetriebener Bugstrahlruder verursacht sie zumindest bei den An- und Ablegemanövern in den Hafenbereichen keine Emissionen.
Die Kapazität der neuen Fähren wird voraussichtlich für jeweils etwa 1.000 Passagiere sowie für Fahrzeuge auf einer Gesamtlänge von 3.000 Lademetern reichen. Kern des technischen Konzepts sind Akkus mit einer Kapazität von 60 - 70 MWh, die eine Fahrt im Elektromodus über die komplette Strecke von etwa 100 km ermöglichen. Die Stena Line prüft aber auch die Kombination der Elektrifizierung mit fossilfreien Kraftstoffen wie Wasserstoff und Biomethanol für eine größere Reichweite der Schiffe.
Hinter dem Plan steht die Tranzero Inititiative, zu der sich Stena Line, die Volvo Group, Scania und der Hafen von Göteborg zusammengetan haben und deren Ziel es ist, die CO2-Emissionen im größten Hafen Skandinaviens bis 2030 um 70 % zu reduzieren.
Im September 2022 wird berichtet, daß die Stena Line u.a. dem dänischen Energieversorger Ørsted, der heimischen Firma Liquid Wind und dem Hafen von Göteborg zusammengetan habe, um in Schweden gemeinsam die für die Produktion von klimafreundlichem E-Methanol benötigte Infrastruktur aufzubauen. Bei der Recherche zeigt sich, daß Methanol-Projekt von Stena Line formal im Jahr 2014 mit der Entscheidung begann, die Fähre Stena Germanica auf der Route Göteborg–Kiel auf Methanolantrieb umzurüsten. Da dieses Methanol allerdings in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt, wird die Sache hier nicht weiterverfolgt.
Erwähnenswert ist dagegen, daß der Stena im Oktober 2024 von der Werft China Merchants Jinling Shipbuilding (Weihai) Co. Ltd. (o. CMI Weihai) das bislang weltgrößte 12 MWh Hybrid-Passagier-Ro-Ro-Schiff ausgeliefert wird. Zusammen mit dem Energieintegrator Wärtsilä installiert die AYK Energy Ltd. anschließend innerhalb von sechs Monaten das Schiffsenergiesystem. Im Juni 2025 ist die Stena Foreteller auf dem Weg, die Stena Forerunner zu ersetzen, die im Anschluß ebenfalls umgebaut wird.
Die Stena Foreteller gehört zur Stena 4Runner Mk II Klasse von drei RoRo-Schiffen, die zwischen 2000 und 2003 bei der Dalian Shipyard in China gebaut wurden. Bei dem aktuellen Umbau werden die Schiffe mit einem zusätzlichen Deck ausgestattet und so die Frachtkapazität um 30 % erhöht.
Im Oktober 2022 unterzeichnet die schwedische Verkehrsbehörde Trafikverket
Sweden mit der Holland Shipyards Group in
den Niederlanden einen Vertrag über die Lieferung von vier autonomen,
vollelektrischen Fähren. Der Vertrag umfaßt die Fähren, acht Autoverladeanlagen,
vier Ladestationen, eine Simulatoranlage und eine Fernsteuerungszentrale.
Die Fähren mit einer Größe von 86 x 14,2 m und einer Ladekapazität von bis zu 60 Fahrzeugen sollen autonome Schiffe der Stufe 2 (IMO) sein, d.h., sie werden von Stockholm aus fernüberwacht und -gesteuert, haben aber eine Besatzung an Bord, die bei Bedarf die Kontrolle übernehmen kann. Das Überqueren der Fährrouten kann dadurch mit nur einem Knopfdruck erfolgen. Die erste Fähre soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert werden, und die weiteren Fähren werden in gleichmäßigen Abständen nach der ersten eintreffen. Mehr über autonome Schiffe folgt in einem späteren Schwerpunkt.
Ebenfalls interessant ist die Meldung im Februar 2023,
der zufolge Forscher an der Chalmers University of Technology in
Schweden die induktive Ladetechnik weiter vorantreiben,
um das Laden von Hochleistungsbatterien ohne menschliche Beteiligung
oder einen Roboterarm zu ermöglichen. Ein Team um Prof. Yujing
Liu entwickelt ein 500 kW Induktionsladesystem, das sich für
das Aufladen von Elektrofähren, Lastwagen und Bussen eignet. Es überträgt
500 kW pro 2 m2 mit einem Luftspalt von 15 cm zwischen dem
Bodenpad und dem Onboard-Pad mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 %.
Im Folgenden werden chronologisch Beispiele aus anderen Ländern aufgeführt, geordnet nach ihrem erstmaligen Auftreten in der Presse und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ihre Reihenfolge wurde bereits am Anfang dieser Seite angegeben.
Im Mai 2013 nimmt in Frankreich auf der Garonne der erste von zwei Hybrid-Katamaranen den Betrieb als Personen- und Fahrradfähre auf, die von der Werft Dubourdieu in Gujan-Mestras gebaut werden. Er trägt den Namen BatCub (o. Bat’Cub, für bateaux de la CUB, CUB = Großraum Bordeaux).

Mit der 2016 erfolgenden Umbenennung des Transportsystems von Bordeaux in Transport Bordeaux Métropole (TBM) wird auch der BatCub umbenannt, in Le Bateau de Bordeaux Métropole und später in La Gondole. In diesem Jahr folgt zudem der zweite Katamaran, der zuerst Bat3 genannt wird, bevor er den Namen L’Hirondelle erhält.
Die Hybridfähren mit Batterie- und Dieselantrieb, die Teil des öffentlichen Nahverkehrssystems sind, sind mit Batterien der Saft GmbH ausgestattet und können jeweils 45 Passagiere und sechs Fahrräder transportieren.
Die Loire wurde als einziger westeuropäischer Fluß nicht kanalisiert
und gilt damit als letztes ,wildes Gewässer’ Europas. Ihr unberechenbarer
Wasserstand macht ein Befahren mit klassischen Kreuzfahrtschiffen
unmöglich.

Mit dem Schaufelradschiff Loire Princesse entwickelt die Reederei CroisiEurope im Jahr 2015 das erste und einzige Schiff, daß die Loire bereist. Die Tour führt in sechs Tagen von Nantes über St. Nazaire bis Chalonnes-sur-Loire. Mit 55 Schiffen ist CroisiEurope Europas übrigens größte Flußreederei.
Die Kombination aus flach gestaltetem Rumpf und hybridem Schaufelrad-/Jetantrieb erlaubt es dem mit 48 Kabinen relativ kleinen Schiff, selbst die seichten, kurvenreichen Abschnitte der Loire sicher zu befahren, historische Schleusen zu passieren und vor kleinen Winzerdörfern zu ankern.
Im April 2018 geht die solarbetriebene Ausflugsfähre Bernard Palissy III (o. BP-III) in Betrieb, die von den Elektrohybrid-Experten von Alternatives Energies aus La Rochelle in Zusammenarbeit mit den Schiffsarchitekten und Designern von Ship-ST gebaut worden war.

Das Boot ist der Nachfolger des in den frühen 2010er Jahren auf der Charente in Betrieb genommenen und ebenfalls solarbetriebenen Katamarans Bernard Palissy II, der für 149 Passagiere ausgelegt war. Die Gesamtinvestition für das Projekt beläuft sich auf 638.700 €, an denen sich der Europäische Fonds für regionale Entwicklung mit 80.000 € beteiligt.
Das nach dem Keramikkünstler und Wasserbauingenieur aus dem 16. Jahrhundert Bernard Palissy benannte neue Schiff ist 24,79 m lang und 6,21 m breit und besitzt zwei 36 kW Motoren, zwei 85 kWh Lithium-FePO4-Batterien sowie 12 m2 Photovoltaikmodule. Es hat eine Kapazität von bis zu 100 Passagieren, von denen 60 das Sonnendeck auf dem Dach nutzen können. Das Schiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h, fährt während der normalen Rundfahrt aber gemächlicher und kann an sonnigen Tagen bis zu 90 km zurücklegen, an Standardtagen sind es 56 km.

Frankreich hat eine lange Tradition im Elektrobootsport und war eines der ersten Länder, das 1994 einen Verband für Elektroboote gründete - die Association Française pour le Bateau Electrique (AFBE).
Auch Alternatives Energies kann auf eine lange Geschichte im Bereich der Elektroantriebe zurückblicken, denn das Unternehmen baute bereits 1998 sein erstes Elektroschiff für die Communauté d’Agglomération de La Rochelle, eine 10,2 m lange und 3,5 m breite Fähre mit zwei 16 kW Motoren und zwei 30 kWh Batterien sowie 35 Sitzplätzen namens Passeur Electrique, die den Alten Hafen mit La Ville en Bois verbindet, bis sie und ihr 2003 in Dienst gestelltes Schwesterschiff Passeur II im März 2019 durch die neuen solarelektrischen Wasserbusse Volta und Ampere mit verbesserten elektrischen Antriebssystemen und größerer Kapazität ersetzt wurden.
Diese Schiffe bieten modernen Komfort für Pendler und Touristen mit Platz für etwa 70 Passagiere und haben eine maximale Betriebsdauer von rund zwölf Stunden, was Reichweiten von 90 - 100 km ermöglicht.

Die Firma hat darüber hinaus noch diverse weitere Solar- und Elektrofähren gebaut, wie z.B. die vier Millennium-Fähren (Navettes du Millénaire) L’Estrée, Le Montjoie, Le Flandre und Le Lendit, Katamarane mit einer Länge von 15 m und einer Breite von 5 m, die zwischen 2006 und 2013 in Dienst gestellt werden und jeweils 75 Passagiere transportieren können. Sie sind mit zwei 22 kW Pod-Motoren und zwei 55 kWh Lithium-FePO4-Batterien sowie 21 m2 Photovoltaikmodulen mit 2,7 kW ausgestattet.
Die Wasserbusse pendeln mit einer Frequenz von zehn Minuten zwischen der Metrostation Corentin Cariou im Norden von Paris und dem Parc du Millénaire. Bei einer Dienstgeschwindigkeit von 6 Knoten und einer Höchstgeschwindigkeit von 9 Knoten beträgt ihre Einsatzdauer bis zu 12 Stunden. Der sehr geringe Verbrauch der Shuttles führt zu Energiekosten pro Shuttle von weniger als 1,5 € pro Tag.
In den Jahren 2008 und 2010 werden zwei Seebusse (bus de mer) in Dienst gestellt, die die 2,5 km lange Verbindung zwischen dem Alten Hafen von La Rochelle und dem Jachthafen Les Minimes bedienen. Die Katamarane sind 15 m lang, 5 m breit und mit zwei 22 kW Unterwasser-Pod-Motoren, zwei 60 kWh Batterien sowie 4 kW PV-Modulen auf 26 m2 ausgestattet. In Spitzenzeiten fährt jeder Bus 15 Umläufe ohne Nachladen, was einer Tagesstrecke von 70 km entspricht. Dabei fahren die für 75 Personen ausgelegten Schiffe mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 6 Knoten, obwohl sie auch 9 schaffen könnten.

in Marseille
Ab 2010 ist im Alten Hafen von Marseille eine zu 100 % elektrisch betriebene Fähre in Betrieb, die 270 Mal am Tag 45 Passagiere transportiert und 18 Stunden lang ununterbrochen in Betrieb ist. Das von Jean-Frasca entworfene und auf der Gatto-Werft gebaute Schiff nutzt von Alternatives Energies selbst entwickelte elektrische PODs, die an beiden Enden des Schiffes in der Achse installiert sind, um der Symmetrie des Vorwärts-Rückwärts-Betriebs gerecht zu werden und unabhängig von der Richtung des Schiffes den besten Wirkungsgrad zu erzielen.
Dank der Effizienz dieses Antriebs verbraucht das Fähreboot bei einer Betriebsgeschwindigkeit von 4 Knoten weniger als 2 kW. Die Energie wird von monokristallinen Solarzellen auf dem Dach und von Batteriepacks auf Nickelbasis geliefert, die nachts aufgeladen werden. Bei gutem Wetter deckt die Sonneneinstrahlung allein den Energiebedarf.
Im Jahr 2014 folgen die zwei EcoBatoBus genannten Busse L’Estello und Longo-Mai in Toulon, die mit seriellen Hybridantriebs-Energiesystemen ausgestattet sind. Der Antrieb erfolgt durch zwei 120 kW Elektromotoren und die Energie wird abwechselnd durch zwei 85 kWh Lithium-FePO4-Batterien und einen 340 kW Generator bereitgestellt. Die Schiffe mit Platz für 98 Personen durchqueren die Reede von Toulon (5 km) 30 Mal am Tag.
Die 21,35 m langen und 5,15 m breiten Wasserbusse fahren mit 7 Knoten rein elektrisch, wenn sie sich den Häfen nähern (etwa die Hälfte der Zeit), und mit 12 Knoten im Generatorbetrieb während der Durchfahrt durch die Reede. Die Reichweite mit der Batterie allein beträgt acht Stunden bei 6 Knoten oder zwei Stunden bei 12 Knoten.
Ab 2015 wird von der Gesellschaft Vedettes de l’Odet in Concarneau ein Elektrokatamaran mit einer Länge von 27 m und einer Breite von 8,51 m eingesetzt. Die Stromversorgung des Capitaine Némo genannten Pendelbussses erfolgt über Batterien, er hat verstellbare Propeller und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von maximal 10 Knoten. Und in Indien geht 2017 die von Alternatives Energies gebaute ADITYA in Betrieb (s.u.).
In den Jahren 2017 - 2018 wird zehn Monate lang eine Wasserstoffversion des o.e. bus de mer betrieben, wobei das Experiment von mehreren Partnern getragen wird: Alternatives Energies, Michelin R&T, HP systems, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, EVE System, ADEME und die Region Nouvelle Aquitaine. Die Galileo (o. Galilee Yalo H2) wird als das erste Passagierschiff auf See bezeichnet, das Wasserstoff als Energiequelle nutzt.
Die Leistung der Brennstoffzelle beträgt 10 kW, die Ladezeit des Wasserstofftanks mit 7 kg H2 bei 350 bar - was etwa 100 kWh entspricht - rund zehn Minuten. Das Versuchsboot ist auf der Verbindung Vieux Port – Les Minimes bis zu zwölf Stunden pro Tag unterwegs, zur Hälfte mit Batterie, zur Hälfte mit Wasserstoff.
Mitte Juli 2019 beginnt die Stadt Rouen in der Normandie mit der Erprobung eines solarbetriebenen Fluß-Shuttles, das während der Hauptverkehrszeiten unter der Woche durchgehend und an den anderen Tagen im Halbstundentakt verkehren soll, um Menschen von einem Seineufer zum anderen zu bringen. Den Betrieb und die Planung des Dienstes koordiniert Transdev mobility, das 90 Fähren, Fluß-Shuttles und andere Seetransportmöglichkeiten in fünf Ländern betreibt, während das Energieunternehmen Engie für das solar-elektrische Energiemanagement verantwortlich ist. Die Testphase soll bis November dauern.

Bei der Felix de Azara handelt es sich um einen 17 m langen Katamaran vom Typ Aquabus C60, der von der Schweizer Schiffbaufirma Grove Boats für die Expo 2008 im spanischen Saragossa gebaut worden war. Seit ihrer Zeit auf der Weltausstellung ist das Boot in verschiedenen Diensten als Shuttle in Paris und als Sightseeing-Boot in Lille bei Lyon im Einsatz gewesen. Die verschiedenen Modelle der Aquabus-Serie sind in den bisherigen Jahresübersichten schon mehrfach vorgestellt worden.
Die Felix de Azara bietet Platz für 60 Personen und jede Überfahrt dauert 6 - 7 Minuten. Das Boot verfügt über zwei 8 kW Motoren, die von Solarpaneelen mit einer Fläche von 50 m2 auf dem Dach angetrieben werden. Nach erfolgreichem Testbetrieb wird das Shuttle schrittweise in den regulären Betrieb übernommen.
Im Mai 2020 wird die französische Firma NepTech SAS mit Sitz in Aix-en-Provence gegründet, die innovative maritime Mobilitätslösungen entwickelt. In den Blogs erscheint sie erstmals im Januar 2022, als das von dem Start-Up entwickelte NepShuttle auf der CES mit einem Innovation Award ausgezeichnet wird.

(Demonstrator)
Der geplante 24 m lange und 8,5 m breite Hybrid-Katamaran, dessen Markteinführung für 2023 oder 2024 geplant ist, soll bis zu 170 Passagiere und vier Fahrräder befördern. Seine Karosserie wird aus Flachsfasern, biobasiertem Epoxidharz und recyceltem Kunststoff hergestellt, während der Rumpf eine NepAir genannte Technologie beinhaltet, die kontinuierlich Luftblasen an der Unterseite abgibt, um während der Fahrt die Reibung an der Grenzschicht zu reduzieren - und damit dem System ähnelt, das bei der o.e. Elektrofähre BB Green 24 der schwedischen Green City Ferries (GCF) im Einsatz ist.
Darüber hinaus sollen flache Hydrofoils an der Unterseite der Rümpfe die Stabilität erhöhen, wenn das Boot durch den Wellengang fährt, die im Gegensatz zu herkömmlichen Tragflächen aber nicht so konstruiert sind, daß sie das Boot bei hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser heben.
Die beiden Elektromotoren des Wasserfahrzeugs werden von zwei Lithiumbatterien angetrieben, die ihrerseits von zwei PEM-Brennstoffzellen aufgeladen werden. Deren Betankung kann an einer mobilen Wasserstofftankstelle erfolgen, so daß das Shuttle nicht jedes Mal zu einer Heimatbasis zurückkehren muß, wenn der Treibstoff zur Neige geht. Das NepShuttle, das zunächst auf der Seine und im Hafen von Marseille eingesetzt werden soll, hat eine Reisegeschwindigkeit von 35 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Es kann mit einer Besatzung gefahren werden, ist aber auch in der Lage, autonom zu navigieren und an seinem Zielort anzudocken.

(Grafik)
Das Unternehmen beginnt Mitte 2021, die Technologien in einem Demonstrationskatamaran im Maßstab 1:7 zu testen, der 2,5 m lang, 1,3 m breit und 1,5 m hoch ist. Die Tests erfolgen im Lac de Peyrolles im Norden von Aix-en-Provence, in der Loire-Mündung in der Nähe von Nantes sowie in einer maritimen Umgebung in Monaco während der Monaco Energy Boat Challenge.
Im ersten Schritt zur Entwicklung eines Prototyps in Originalgröße beginnt die NepTech im Juni 2022 eine Zusammenarbeit mit der Firma HySiLabs, die einen sicheren und stabilen Flüssigwasserstoffträger entwickelt hat. Zunächst sollen gemeinsam Machbarkeitsstudien für ein 21,5 m langes Schiff durchgeführt werden, das bis zu 100 Passagiere befördern kann.
Im Februar 2023 schließt die NepTech eine Startkapitalrunde mit 1,2 Mio. € ab, einschließlich 800.000 € an privaten Mitteln. Eigenen Angaben zufolge hat die Firma bereits eine eigene Reihe von elektro-wasserstoffbetriebenen Wassertaxis und Schiffen mit Längen von 10 - 30 entwickelt, die zwischen zehn und 200 Passagiere oder bis zu 20 Tonnen Fracht befördern können. Grafiken und einige Details werden im Mai 2025 veröffentlicht.

der NepTech
Die ersten beiden realen Elektroschiffe der NepTech, die Le Noroît und die Le Suroît, werden im März bzw. Oktober 2024 von dem französischen Gemeindeverband Les Sables d’Olonne Agglomération in Betrieb genommen. Mit einer Länge von 11,90 m und einer Breite von 4,6 m befördern diese Elektrofähren 50 Passagiere (andere Quellen: 70) sowie acht Fahrräder und fahren die wichtigsten Haltestellen rund um den Hafen von Les Sables d’Olonne an.
Daneben wurde ein 13,5 m langes Forschungsschiff mit diesel-elektrischem Hybrid-Antrieb namens INRAe entworfen und geliefert, das seit November in Thonon-les-Bains am Genfer See im Einsatz ist. Es ist mit zwei Laboratorien ausgestattet und bietet Platz für zwölf Personen.
Auch die Niederlanden werden aktiv: So wird auf der Nieuwe Maas im Stadtzentrum von Rotterdam im August 2016 das erste Plug-in-Hybrid-Wassertaxi (PHW) eingesetzt, das mit dem Deep Blue-Hybridsystem der deutschen Firma Torqeedo ausgestattet ist und zwölf Fahrgäste bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h befördern kann. Für den Betreiber Watertaxi Rotterdam ist es das sechzehnte Boot, das nun als das „erste elektrisch betriebene Wassertaxi Europas“ bezeichnet wird.

in Rotterdam
Das Hybridsystem ist das gleiche, das auch im Yachtbau verwendet wird: ein serieller Hybridaufbau mit einem 50 kW Elektroantrieb, kombiniert mit einem Lithium-Batteriepaket und einem 20 kW Generator zur zusätzlichen Stromerzeugung. Anderen Quellen zufolge wurde in dem Wassertaxi ein Doppelgenerator installiert, um je nach Andrang wählen zu können, ob man nur mit Batterien fährt oder einen oder zwei Dieselgeneratoren zuschaltet.
Der Entwurf des PHW stammt von Huibert Groenendijk, dem ständigen Designer der Flotte von Watertaxi Rotterdam, die nautische Architektur von Triple-Marine. Die Entwicklung des Prototyps dauerte zwei Jahre und wurde durch einen Zuschuß des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Mit der Zeit soll die Wassertaxi-Flotte um mehrere weitere PHWs verstärkt werden.

Ende August 2022 tauft Watertaxi Rotterdam das wasserstoffelektrische Modell MSTX 22 als jüngstes Mitglied der Flotte, das im regulären Betrieb für Fährdienste eingesetzt wird. Das 8,8 m lange Schiff mit einer Kapazität von bis zu zwölf Passagieren, dessen Antriebsstrang von einem Y50-Brennstoffzellenmodul angetrieben wird, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 13 Knoten (24 km/h) und hat mit 14 kg Wasserstoff an Bord eine Betriebsautonomie von neun Stunden bei Reisegeschwindigkeit.
Das MSTX 22 ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Watertaxi Rotterdam und dem SWIM genannten Konsortium, das aus Enviu, Flying Fish und Zepp.solutions B.V. besteht. SWIM hatte Anfang 2020 mit der Entwicklung des Antriebsstrangs begonnen, wobei die 2017 gegründete, niederländische Zepp.solutions für die Entwicklung und Integration des Wasserstoff-Brennstoffzellensystems und des Wasserstoffspeichersystems verantwortlich war.
Nach mehreren Projekten im Schwerlast- und Bausektor ist dies der erste maritime Einsatz des schlüsselfertigen Y50-Moduls, einer Brennstoffzellenlösung, die alle Komponenten, Subsysteme und Steuerungssoftware enthält, die erforderlich sind, um Wasserstoffgas mit maximaler Effizienz und Betriebsstabilität in elektrischen Strom umzuwandeln.
Hierzu passend investieren der Hafenbetrieb Rotterdam, das Energieunternehmen Uniper und Shell bereits kräftig in Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff auf der Maasvlakte, wo Shell 2023 die erste Fabrik dafür eröffnen will, gefolgt von einer zweiten Wasserstoffabrik des Hafenbetriebs Rotterdam und Uniper bis 2024.
Im März 2020 bestellt der niederländische Verkehrsverbund GVB Exploitatie B.V., der die U-Bahn, die Straßenbahn, die Stadtbusse und die Fähren der Hauptstadt Amsterdam betreibt, mehrere Batteriefähren der NZK-Serie, die auf der lokalen Werft Holland Shipyards (o. Holland Ship Electric BV) in Hardinxveld-Giessendam gebaut und in den Jahren 2021 und ausgeliefert werden. Der Entwurf stammt vom Schiffsarchitekturbüro C-Job Naval Architects in Hoofddorp.

Die für 400 Passagiere und 20 Pkw oder vier Lkw zugelassenen, 41 m langen und 13,9 m breiten Elektrofähren werden durch zwei Motoren mit jeweils 300 kW Leistung angetrieben, die ihren Strom von zwei Lithium-Ionen-Akkubänken von Corvus Energy mit einer Kapazität von jeweils 340 kWh beziehen. An den Anlegern in Zaandam, Assendelft und Velsen-Noord stehen Ladeeinrichtungen mit 1,6 MW zur Verfügung, wo die Doppelendfähren für einige Minuten automatisch geladen werden. Für besondere Situationen sind die Fähren zusätzlich mit einem Dieselgenerator ausgerüstet.
Die vollelektrischen Fähren werden auf drei Nordseekanalrouten westlich von Amsterdam eingesetzt und ersetzen die bisherige, in den 1930er Jahren gebaute Flotte. Die Strecken im Nordseekanal gehören zu den am stärksten befahrenen Routen der Region, auf denen jährlich mehr als 350.000 Autos befördert werden.
In Finnland bestellt die lokale Schiffahrtsgesellschaft FinFerries im März 2016 bei der polnischen Werft CRIST S.A. den Neubau der ersten batteriebetriebenen Autofähre in Finnland, die fast 98 m lang und 16 m breit sein wird und bis zu 90 Autos transportieren kann.

Ausgerüstet wird die Fähre mit drei Dieselgeneratoren mit einer elektrischen Leistung von 420 kW sowie dem elektrischen Antriebssystem BlueDrive PlusC von Siemens, das zwei 530 kWh Lithium-Ionen-Batterien, das Strahlruder, eine drehzahlveränderbare Antriebstechnik für die zwei 900 kW Propeller sowie ein integriertes Alarm- und Überwachungssystem umfaßt.
Die komplette elektrotechnische Lösung, die als Folgeauftrag der im Mai 2015 in Norwegen in Dienst gestellten Ampere betrachtet wird (s.o.), umfaßt auch die Fernüberwachung EcoMain sowie die Ladestationen an Land, bei denen eine WLAN-Lösung für eine automatische Schnelladung sorgt, die vom Energiemanagementsystem der Fähre aus gesteuert wird. Die Akkus der Fähre werden innerhalb von rund fünf Minuten jeweils am Abfahrts- und Ankunftshafen aufgeladen, wo der Landanschluß an das örtliche Netz besteht.
Wegen der rauhen Winterbedingungen in Finnland besteht die Möglichkeit, daß die Elektra genannte Elektrofähre einen Dieselmotor als zusätzlichen Antrieb für die Bordbatterien einsetzt, wenn sie auf ihrer Fahrt - dann quasi als Plug-in-Hybrid - durch Eis fahren muß. Sobald ihr Einsatz im Südwesten des Landes im Sommer 2017 beginnt, soll sie die Verkehrsmöglichkeiten zwischen Nauvo und Parainen im Schärengebiet Turku verbessern, einer 1,6 km langen Strecke.
Eine weitere Fähre von FinFerries, die 2012 gebaute und zwischen Korpo und Houtskär in Finnland verkehrende Stella, ist übrigens an der 2014 gestarteten Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative (AAWA) von Rolls-Royce beteiligt, um an Bord verschiedene Sensortechnologien zu testen, die für einen zukünftigen autonomen Betrieb von Schiffen erforderlich sind. Die Ergebnisse sollen in den Bau eines entsprechenden Proof of Concept-Demonstrators fließen.
Im Januar 2017 unterzeichnet die finnische Reederei Viking
Line Abp, die zu dem US-Schiffbauunternehmen Vigor gehört
(s.u.), eine Vereinbarung mit der oben bereits erwähnten finnischen
Firma Norsepower Oy, um die im Jahr 2013 in
Dienst gestellte Kreuzfahrtfähre MS Viking Grace,
die bis zu 2.800 Personen befördern kann, mit einem mittelgroßen Rotor-Segel
mit einer Höhe von 24 m und einem Durchmesser von 4 m auszustatten.
Bei der Schiffslänge von 218 m und einer Breite von 31,8 m wirkt der
Rotor allerdings etwas unterdimensioniert.

Mit Installation der modernisierten Version des Flettner-Rotors, der im Kapitel Windenergie ausführlich beschrieben ist, wird die mit LNG betriebene Fähre, die in den Schären zwischen Turku in Finnland und Stockholm in Schweden verkehrt, zum weltweit ersten kommerziell genutzten Hybridschiff mit LNG-/Windkraftantrieb. Die Technik funktioniert vollautomatisch und erkennt, wenn der Wind stark genug ist, um Treibstoff einzusparen. In diesem Fall wird der Rotor automatisch gestartet. Je nach den Windverhältnissen auf der jeweiligen Route, kann die Technologie zu Treibstoffeinsparungen von bis zu 20 % pro Jahr führen.
Die Installation der modernen ,Hilfswindantriebstechnologie’ erfolgt im Oktober 2018, woraufhin die Fähre direkt wieder in Betrieb genommen wird. Nach der Testphase, die bis zum Frühjahr 2021 dauert, bewertet Viking Line die Technologie zwar als „vielversprechend für klimafreundlichen Seeverkehr“, doch der Rotor wird trotzdem im April wieder abgebaut.
Im April 2017 wird in der Stadt Turku die Fähre Föri wieder
in Betrieb genommen, die 1904 zunächst als Dampfschiff
in den Dienst gestellt wurde, um bis zu 75 Passagiere gleichzeitig
über den Aurajoki zu transportieren. 1953 (andere
Quellen: 1955) wurde das orangefarbene kleine Schiff
dann mit Dieselmotoren ausgestattet. 2015 entschließt
sich die Stadtverwaltung, einen weiteren technologischen Evolutionsschritt
zu machen, um das erste vollelektrische Fahrgastschiff Finnlands
durch Batterien mit Strom zu versorgen.

Mit dem Entwurf und der Entwicklung der leisen, effizienten und kostengünstigen Lösung für den Personentransport beauftragte die Stadt die lokale Werft Mobimar, die den Maschinenraum komplett neu konfigurierte und den dieselbetriebenen Hydraulikmotor des Schiffs sowie die alte Steuerung ausbaute. Da die Zuverlässigkeit von wesentlicher Bedeutung ist - die Föri ist ein wichtiger Bestandteil des örtlichen Nahverkehrssystems -, entscheidet man sich bei der Elektrifizierung für Danfoss Editron, die ein emissionsfreies elektrisches Antriebssystem liefern.
Zwei Jahre nach ihrer Einführung hat die Elektrofähre Föri die Erwartungen weit übertroffen. Sie verbraucht im Sommer weniger als 3 kWh und im Winter 4 kW Energie pro Stunde - und Fahrgäste und Arbeiter auf der Fähre genießen eine sauberere Luft, weil das Schiff keine Abgase mehr abgibt. Die Fähre führt 400 Fahrten pro Tag über einen Zeitraum von 17 Stunden durch, was etwa 140.000 Fahrten pro Jahr entspricht. Nur an Tagen, an denen die Eisdecke auf dem Fluß über 20 cm dick ist, stellt sie ihren Betrieb ein.

(Grafik)
Im Herbst 2019 erteilt Finnlines,
Teil der italienischen Grimaldi-Gruppe, einen Auftrag an Wärtsilä zur
Lieferung von Hybrid-Energieumwandlungssystemen für drei neue, 238
m lange RoRo-Fähren, die auf der Nanjing Jinling-Werft
in China gebaut werden.
Die Hybridlösung, zu der auch ein 5 MWh Energiespeichersystem gehört, wird es den Schiffen ermöglichen, im Hafen emissionsfrei zu fahren. Die Ausrüstungen von Wärtsilä, zu denen auch Generatoren, Umformer und Transformatoren gehören, sollen im zweiten Halbjahr 2020 an die Werft geliefert werden.
Anfang Juni 2025 gibt die Viking Line Abp den Bau
der ersten vollelektrischen Großfähre der Welt, der Viking
Helios, bekannt. Die Reederei mit Hauptsitz in Mariehamn
in der autonomen finnischen Region Åland ist mit fünf Fährschiffen
im Linienverkehr auf der Ostsee zwischen Estland, Finnland und Schweden
tätig und beförderte im Vorjahr über 4,6 Mio. Passagiere.
Das Konzept sieht eine RoPax-Fähre mit 85 – 100 MWh Batteriekapazität vor, die emissionsfrei zwischen Helsinki und Tallinn verkehren soll. Mit 23 Knoten soll die 80 km lange Überfahrt in etwas mehr als zwei Stunden gefahren werden. Das Schiff mit einer Länge von etwa 195 m und Platz für rund 2.000 Passagiere, Pkw und 2.000 Spurmeter für Lkw, das sich noch in der Planungs- und Ausschreibungsphase befindet, soll auf der Rauma-Werft gebaut und in den frühen 2030er Jahren in Dienst gestellt werden.
In den USA verfolgt ein Team der Sandia National Laboratories (SNL) des US-Energieministeriums den Plan, den Bootsverkehr mit Wasserstoff durch eine Brennstoffzellen-Pendlerfähre in San Franciscos Bay Area in Gang zu bringen. An dem Projekt arbeitet auch das US-Ingenieurunternehmen für Schiffbau und maritime Technik Elliott Bay Design Group (EBDG) mit.

(Grafik)
Wie im Oktober 2016 berichtet wird, belegt eine Machbarkeitsstudie namens SF-Breeze, daß sich diese Antriebsform auch für große Schiffe eignet. Die geplante Wasserstoffähre soll mit 150 Passagieren an Bord auf 35 Knoten (64,8 km/h) beschleunigen, die Reichweite liegt bei 80 km.
Um die geforderte Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, hat das Team den Katamaran mit einem überdurchschnittlich langen Rumpf ausgestattet, und da die Brennstoffzellen Elektroantriebe mit Strom versorgen, dürfte das Boot auch schneller auf Eingaben reagieren und damit wendiger sein als ein Dieselfahrzeug. Der Wasserstoff wird in einem vollständig geschlossenen Bereich des Hauptdecks gelagert, um sicherzustellen, daß er stets von den Passagieren getrennt bleibt.
Ein großes Hindernis bei der kommerziellen Umsetzung sind allerdings die Kosten - den Forschern zufolge dürfte eine Wasserstoffähre in der Anschaffung etwa dreimal so teuer sein wie ein herkömmliches Dieselschiff, und auch die Betriebskosten dürften deutlich höher sein als bei einem Dieselmotor.

Die SF-Breeze-Pläne werden daher nie verwirklicht, doch basierend auf den Erkenntnissen aus der Studie wird von der 2018 gegründeten Firma SWITCH Maritime LLC später ein kleinerer Aluminium-Katamaran für 75 Personen realisiert, der im dritten Quartal 2021 in der Bucht von San Francisco in Betrieb genommen werden soll. Die Hornblower Group ist für das Management und die Überwachung des Baus zuständig, während Incat Crowther für das Design des Schiffes verantwortlich ist. Das Projekt wird zum Teil durch einen Zuschuß des California Air Resources Board (CARB) in Höhe von 3 Mio. $ finanziert.
Die 22 m lange Passagierfähre Sea Change wird von 242 kg (andere Quellen: 246 kg) Wasserstoff angetrieben, der in ihren Tanks auf 250 bar komprimiert ist und etwa 7 MWh (andere Quellen: 8,3 MWh) gespeicherter Energie entspricht. Dies reicht dies, um die Fähre zwei volle Tage lang zu betreiben. Das Auftanken zwischen den Fahrten dauert allerdings 2 - 3 Stunden insgesamt: 1 - 1,5 Stunden zum Tanken, sowie 1 - 1,5 Stunden für den Auf- und Abbau.
Eine 360 kW PEM-Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff in Strom um, und ein Lithium-Batteriepaket bietet 100 kWh Pufferenergie. Es ist in zwei 50 kWh Racks in jeweils einem der beiden Rümpfe der Katamaranfähre untergebracht. Zwei 300 kW (400 PS) Elektromotoren bringen das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten, während die Reisegeschwindigkeit 12 - 13 Knoten beträgt.
Im Jahr 2020 erhält die öffentliche Water Emergency Transportation Authority (WETA) von der California State Transportation Agency (CalSTA) einen Betrag von 9 Mio. $, um die Fähre zusammen mit der landseitigen Infrastruktur zu entwerfen und zu bauen.
Die als das „weltweit erste kommerzielle Brennstoffzellen-Shuttle“ bezeichnete Fähre, die als Technologie-Demonstrationsplattform für das nachfolgende Water-Go-Round-Projekt dienen soll, wird im August 2021 ausgeliefert. Sie soll nun drei Monate lang Daten für die kalifornische Luftreinhaltungsbehörde sammeln und dann an die San Francisco Bay Ferry (SF Bay Ferry) vermietet werden, die als Teil der WETA 16 Schiffe zu kalifornischen Gemeinden wie Oakland, Richmond und Vallejo betreibt.
Anfang 2022 folgt ein Zuschuß der Federal Transit Administration (FTA) in Höhe von 3,4 Mio. $, um ein weiteres batterieelektrisches Schiff in das Netz aufzunehmen. Und im Juli folgen über das Transit and Intercity Rail Capital Program (TIRCP) der CalSTA zusätzliche 14,9 Mio. $, mit denen der Bau eines dritten Schiffes finanziert werden soll, so daß das San Francisco Clean Ferry Network schließlich aus vier Schiffen bestehen wird.
Im April wird gemeldet, daß die auf der Werft All American Marine (AAM) in Bellingham gebaute Sea Change zwischenzeitlich von der United States Coast Guard (USCG) getestet wurde und die behördliche Genehmigung der für Wasserstoffantriebs- und -speichersysteme erhalten habe. Sie wird zukünftig als Teil der SF Bay Ferry-Flotte betrieben werden. Spätere Quellen berichten jedoch, daß die Fähre tatsächlich erst im August 2023 vom Stapel gelaufen sei und im Juli 2024 den kommerziellen Betrieb aufgenommen habe.

(Montage)
Im November 2023 nimmt die SWITCH Maritime in einer von Nexus Development Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 10 Mio. $ ein, um ihre Flotte zu vergrößern. Die Firma arbeitet aktiv an weiteren Erweiterungsentwürfen für emissionsfreie Fähren mit einer Kapazität von 150, 300 und 450 Passagieren, deren Baubeginn Mitte 2024 und deren Inbetriebnahme Anfang 2026 erfolgen soll.
Ebenfalls im November wird mit Wärtsilä eine strategische Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um die Flottenelektrifizierungs- und Systemintegrationsdienste der Firma für das Projekt zum Bau der ersten elektrischen Hochgeschwindigkeitsfähren für die WETA bereitzustellen. Das Projekt ist Teil des Rapid Electric Emission-Free (REEF) Ferry Program der Behörde zur schrittweisen Dekarbonisierung des Fährdienstes in der San Francisco Bay.
Nach Abschluß der Konzeptphase wird die WETA mit der ersten Bauphase eines Mehrschiffprogramms beginnen, in der Phase drei kleinere Fähren mit einer Kapazität von jeweils etwa 150 Passagieren und zwei größere Fähren mit einer Kapazität von mindestens 300 Passagieren gebaut werden. Darüber hinaus umfaßt diese Phase die Einbeziehung von Batterieladestationen. Der Bau des ersten elektrisch angetriebenen Schiffes soll noch vor Ende 2023 beginnen, der kommerzielle Betrieb dann voraussichtlich 2025 aufgenommen werden. Doch es gibt Verzögerungen.

(Grafik)
Der Auftrag an Wärtsilä wird schließlich im Mai 2025 von der AAM-Werft erteilt, welche die drei batterieelektrischen Hochgeschwindigkeitsfähren für SF Bay Ferry bauen wird. Die Ausrüstung soll nun ab 2026 geliefert werden, und das erste Schiff wird voraussichtlich Anfang 2027 in die Fährflotte aufgenommen. Das anfängliche Konzeptdesign der 150-Passagier-Fähren wurde von Aurora Marine Design geliefert, während Teknicraft mit dem detaillierten Design der Schiffe betraut wird.
Die Fähren werden 30,48 m lang sein, eine Breite von 7,9 m haben und von zwei 625 kW Elektromotoren angetrieben mit einer Geschwindigkeit von 24 Knoten fahren. Eingesetzt werden sie auf neuen Strecken, die Treasure Island und Mission Bay mit dem Fährhafen von SF Bay Ferry in Downtown S.F. verbinden.
Im Rahmen des REEF-Projekts bestellt die WETA zudem im April 2025 zwei batteriebetriebene Fähren für 200 Passagiere bei Nichols Brothers Boat Builders (NBBB), die ebenfalls zusammen mit Incat Crowther, Wärtsilä und Ockerman Automation Consulting, einer Firma für Elektrotechnik, gebaut werden sollen.
Zusätzlich zu den neuen batterieelektrischen Schiffen umfaßt das REEF-Programm der SF Bay Ferry dem aktuellen Stand zufolge die Umrüstung von vier Dieselfähren mit einer Kapazität von 400 Personen auf Nullemissions-Technologie, die Terminal-Elektrifizierung im gesamten Bereich sowie die Erweiterung und Elektrifizierung der Betriebs- und Wartungsanlage in der Central Bay in Alameda.
Im August 2025 folgt eine Finanzierung in Höhe von 2 Mio. $ von der New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), um die Fähre mit Brennstoffzellenantrieb zu entwickeln und vor Ort zu demonstrieren. In diesem Zusammenhang ist zu erfahren, daß die SWITCH Maritime mit LH2 Shipping und LMG Marin auch am Bau der ersten mit Flüssigwasserstoff betriebenen RoPax-Fähre in den USA zusammenarbeitet, einem Nachbau der bestehenden RoPax-Fähre MF Hydra, die in Norwegen mit Flüssigwasserstoff betrieben wird (s.o.).
Im November 2018 findet in der kalifornischen Werft Bay Ship & Yacht die Kiellegung für das Brennstoffzellen-Schiff Water-Go-Round (o. Water Go Round) statt, ein 21 m langer Katamaran, der 84 Personen befördern kann. Dem in diesem Jahr gegründeten Start-Up Golden Gate Zero Emission Marine (GGZEM) zufolge, ein SNL-Spinoff, hinter dem ein Zusammenschluß mehrerer Unternehmen steht, soll das Schiff voraussichtlich im September 2019 fertig sein und dann zunächst drei Monate lang testweise in der San Francisco Bay als Fähre eingesetzt werden.

(Grafik)
Unterstützt wird das Projekt von der Regierungskommission California Air Resources Board, die für ihre strengen Gesetzesvorschläge für die Luftreinhaltung bekannt ist und bereits im Juni einen Zuschuß in Höhe von 3 Mio. $ für den Bau des neuen Aluminiumkatamarans bereitgestellt hatte, dessen Gesamtkosten von 5,5 Mio. $ betragen.
Ebenfalls mit dabei sind die herstellende Firma Incat Crowther mit Sitz in Sydney, die als Spezialist für Fähren und Schnellboote bekannt ist, sowie die Reederei Red and White Fleet, welche die Fähre kaufen will, um Besichtigungsfahrten in der San Francisco Bay anzubieten. Die Reederei arbeitet zusammen mit Sandia und anderen Partnern seit 2014 an Wasserstoff-Brennstoffzellen und will bis 2025 nur noch emissionsfreie Schiffe einsetzen. Es war auch der Präsident von Red and White, Tom Escher, der 2015 den Anstoß zu der o.e. Studie gab, während der Teamleiter der Machbarkeitsstudie, Joe Pratt, Mitbegründer von GGZEM wurde.
Der 21 m lange Katamaran wird von zwei Motoren von BAE Systems mit einer Leistung von jeweils 300 kW (400 PS) angetrieben, und der Wasserstoff wird mit einem Druck von 250 bar in mehreren Tanks auf dem Dach der Fähre mitgeführt, die zusammen 264 kg fassen. Damit soll das Schiff zwei Tage lang unterwegs sein können. Es hat zudem noch eine Batterie mit 100 kWh an Bord, die dafür benötigt wird, das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 22 Knoten (40,7 km/h) zu beschleunigen. Falls die Probefahrten erfolgreich verlaufen, soll bis 2025 eine ganze Flotte Brennstoffzellen-Schiffe zum Einsatz kommen.
Die Inbetriebnahme des Brennstoffzellen-Schiffs Water-Go-Round findet fristgerecht im September 2019 statt - und die GGZEM startet mit dem Bau von weiteren Null-Emissions-Schiffen.

Die All American Marine läßt im Februar 2019 ein von Glosten in Seattle entworfenes, 12 m langes und 7,8 m breites hybrides Elektro-Passagierschiff vom Stapel, das als Wassertaxi dienen wird, um in der Meeresbucht Puget Sound 150 Passagiere zwischen Bremerton, Port Orchard und Annapolis in Washington zu befördern.
Der mit einem HybriDrive-System von BAE ausgestattete Aluminium-Katamaran Waterman des öffentlichen Verkehrsunternehmens Kitsap Transit, das den Bezirk Kitsap in Washington bedient, der zum Großraum Seattle gehört, erreicht eine Dienstgeschwindigkeit von 10 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 Knoten.
Die Waterman ist das zweite Hybrid-Elektroschiff von All American Marine. Das erste war das von Teknicraft Design entworfene und für die Red and White Fleet gebaute Hybrid-Reiseschiff Enhydra mit 600 Passagieren, das vom WorkBoat Magazine zum Boot des Jahres 2018 gekürt wurde. Auch dieses Schiff wird von einem BAE-HybriDrive angetrieben.
Im November 2019 beginnt die Washington State
Ferry (WSF), ein öffentliches Unternehmen des Verkehrsministeriums
des Bundesstaates Washington, das als weltweit zweitgrößte Fährgesellschaft
gilt, unter der Leitung von Washingtons Gouverneur Jay Inslee -
einer der wenigen politischen Führer in den USA, die den Klimawandel
ernst nehmen - mit der Umrüstung drei ihrer größten Jumbo-Mark-II-Fähren
auf Elektro-Hybrid-Antrieb. Allein diese drei Schiffe verbrauchen bislang
5 Mio. Gallonen Kraftstoff pro Jahr.

Olympic-Klasse
Die Tacoma, Puyallup und Wenatchee befördern jeweils bis zu 2.500 Passagiere und fahren in der Regel Routen von sechs Seemeilen in und um Seattle. Die drei Umbauten, bei denen auf jedem Schiff zwei der vier Dieselgeneratoren und Motoren durch Batteriesysteme ersetzt werden, sollen bis 2021 fertiggestellt werden, gefolgt von fünf neuen Schiffen, die zwischen 2022 und 2028 vom Stapel laufen sollen.
Die Umrüstung wird von der amerikanischen Werftengruppe Vigor Industrial LLC (o. Vigor Marine Group) in Seattle durchgeführt, die auch an der neuen Flotte arbeitet. Im Juni 2020 wählt Vigor den schwedisch-schweizerischen Energie- und Technologie-Kozern ABB Ltd. als Lieferanten für das hybrid-elektrische Antriebs- und Energiespeichersystem, nachdem zuvor von Siemens die Rede war.
Nun heißt es, daß die WSF plant, 13 Dieselfähren bis 2040 durch neue Hybrid-Elektrofähren zu ersetzen sowie sechs weitere Fähren auf Plug-in-Hybrid umzurüsten. Insgesamt betreibt das Unternehmen 21 (andere Quellen: 23) Fähren. Zudem sollen an vielen der 20 Fährterminals Lademöglichkeiten installiert werden.
Die neu geplanten Fähren der Olympic-Klasse, die 110,4 m lang und 25,4 m breit sind und jeweils 144 Autos und 1.500 Passagiere befördern können, werden vollständig mit Batteriestrom betrieben, haben aber auch die Möglichkeit, bei Bedarf in den Hybridmodus zu wechseln. Die Auslieferung sollte eigentlich im Jahr 2024 erfolgen, was sich bislang aber nicht belegen ließ.

Immerhin meldet die Vigor im Juni 2025 den erfolgreichen Abschluß der Elektrohybrid-Umrüstung der Wenatchee, eine der größten WSF-Fähren mit einem Fassungsvermögen von 202 Fahrzeugen und zu diesem Zeitpunkt auch die größte elektrifizierte Passagierfähre der USA, die nun wieder auf der Strecke Seattle - Bainbridge eingesetzt wird.
Zu den wichtigsten Arbeiten, die von etwa 700 Mitarbeitern im Laufe von fast 21 Monaten durchgeführt wurden, gehörten der Ausbau von zwei Dieselgeneratoren, der Bau von zwei Batterieräumen, in denen insgesamt 864 Module untergebracht sind, die Installation neuer Antriebskontrollsysteme, Tausende Meter neuer Strom- und Glasfaserkabel sowie die Modernisierung von Bordsystemen und Fahrgastbereichen.
Im Oktober 2018 berichten die Fachblogs über SW/TCH E-Mobility (früher: Optare), ein Unternehmen für elektrische Transportmittel, das sich auf verschiedene Arten des Pendelns mit Elektrofahrzeugen konzentriert und auch in den Bau und Besitz der o.e. E-Fähre Water Go Round der GGZEM investiert.

(Grafik)
Das Unternehmen plant nun, die erste elektrisch betriebene Fähre in New York City einzuführen, kombiniert mit einem breiten Angebot an Elektrofahrzeugen an Land, von Elektro-Vans bis zu E-Scootern und E-Skateboards.
Das Flaggschiff e-Ferry, dessen Entwicklung bereits im Gange sei, wird eine batteriebetriebene Fähre für 150 Passagiere sein, die Williamsburg mit der East Side von Manhattan verbindet. Für die Umsetzung tut sich SW/TCH mit der Impact-Investment-Gruppe Clean Marine Energy (CME) zusammen, die sich auf die Senkung der Emissionen in der Schiffahrtsindustrie durch sauberere Kraftstoffe und die Elektrifizierung von Schiffen konzentriert. Das Projekt soll Ende des Jahres starten - und die Elektrofähre 2019 in Dienst genommen und von einem bestehenden Fährbetreiber privat betrieben werden.
Im Oktober 2020 gehen zwei Ausflugsschiffe der Maid of the Mist Corp. mit vollelektrischem Antrieb in Betrieb, die es den Passagieren ermöglichen, das spektakuläre Erlebnis der Niagarafälle ungestört von Abgasen und Motorenlärm zu genießen. Die Bootstour Maid of the Mist ist seit 1846 auf den Gewässern unterhalb der majestätischen Fälle unterwegs. Die Inbetriebnahme der Fähren war erstmals im Mai 2019 angekündigt worden, und sie sollten bereits ein halbes Jahr später in Betrieb genommen werden, doch es kam zu Verzögerungen.

Niagarafällen
Die emissionsfreien Passagierschiffe - die James V. Glynn und die Nikola Tesla zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden der Maid of the Mist bzw. des bekannten Energiepioniers, der für die Planung und den Bau des ersten Wasserkraftwerks der Welt an den Niagarafällen verantwortlich war - sind die ersten in den USA gebauten vollelektrischen Schiffe, für die ABB eine umfassende integrierte Energie- und Antriebslösung liefert, einschließlich eines Hochleistungsbatteriepakets und eines Onshore-Ladesystems.
Die Tourboote werden jeweils von zwei Batteriepaketen mit einer Gesamtkapazität von 316 kWh angetrieben, die sich auf die zwei Katamaranrümpfe verteilen und den elektrischen Antriebsmotoren erlauben, eine Leistung von bis zu 400 kW zu erreichen. Die Batterien werden mit lokal erzeugtem Strom aus Wasserkraft aufgeladen, was beim Ausschiffen und Einsteigen nur sieben Minuten dauert.
Die Elektrofähren ersetzen zwei dieselbetriebene Boote - Maid of the Mist VI und Maid of the Mist VII, die 1990 und 1997 gebaut worden waren. Ersteres wurde bereits in den Ruhestand versetzt, während das Unternehmen das zweite beibehalten wird, um es auf Elektroantrieb umzustellen.
Im Februar 2023 wird gemeldet, daß die Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) mit der Angel Island Tiburon Ferry Co. (Angel Island Ferry) zusammenarbeitet, um die Elektrifizierung des 1951 in Betrieb genommenen Schiffes Angel Island zu unterstützen, das ab 2024 als „Kaliforniens erste emissionsfreie Kurzstreckenfähre mit Elektroantrieb“ in Dienst gehen soll. Für den etwa 5 Mio. $ kostenden Umbau wird das neu gegründete, in San Rafael ansässige Unternehmen Green Yachts ausgewählt. Ziel ist die Fertigstellung der Elektrifizierung bis Dezember 2025.

Das Projekt stellt eine Ausweitung des Elektrofahrzeugflottenprogramms (EV Fleet Program) von PG&E auf den maritimen Sektor dar und soll Kunden mit mittelschweren und schweren Flotten durch umfassende Unterstützung beim Bau und finanzielle Anreize dabei helfen, einfach und kostengünstig Ladeinfrastruktur zu installieren.
Im April 2024 erhält die Angel Island-Tiburon Ferry Co. einen staatlichen Zuschuß in Höhe von 24 Mio. $ für die Umrüstung ihrer drei Schiffe auf vollelektrischen Betrieb. Die Flotte befördert jährlich etwa 100.000 Passagiere, von denen die meisten den Angel Island State Park besuchen.
Der Zuschuß stammt aus dem ,Advanced Technology Demonstration and Pilot Program’ des Air Resources Board, mit dem emissionsfreie Projekte für Off-Road-Geräte und Schiffe unterstützt werden, und wird durch weitere 7 Mio. $ ergänzt, die unter anderem aus dem Volkswagen Environmental Mitigation Trust und dem Clean Off-Road Equipment Voucher Incentive Project stammen.
Neben der Angel Island soll für schätzungsweise 3 Mio. $ auch die Bonita von Green Yachts umgebaut werden, ein 16 m langes Wassertaxi für 98 Passagiere, das auch für Charterfahrten eingesetzt wird, während das dritte Schiff, die zweistöckige Tamalpais, die 100 Passagiere befördert, verkauft und durch eine neue, 40 m lange Elektrofähre im Wert von 15 Mio. $ ersetzt werden soll.
Die Stadt Tiburon beauftragt die Firma Moe Engineering mit der Verwaltung des Elektrifizierungs- und Infrastrukturprojekts, das auch eine Erweiterung der Anlegestelle für neue Ladegeräte, die Installation von PV-Paneelen auf benachbarten Gebäuden am Wasser und eine Aufrüstung des Stromnetzes von Tiburon umfaßt, deren Kosten die PG&E übernimmt, um die Stromversorgung des Terminals zu verbessern und das Aufladen bis zu fünf Mal am Tag und über Nacht zu unterstützen.
Merkwürdig ist, daß Mitte 2025 über die Green Yachts keinerlei Informationen mehr zu finden sind, auch die Homepage ist abgeschaltet. Allerdings ergibt eine Recherche, daß Green Yachts - die auch nichts mit dem gleichnamigen italienischen Design- und Ingenieurteam Green Yachts zu tun hat - nur der operative Name der 2019 gegründeten ZeroMar Inc. ist, die auch weiterhin präsent, aber etwas undurchsichtig ist.
Zudem geben die ZeroMar und EPTechnologies, ein Pionier im Bereich der elektrischen Schiffsantriebe und Sicherheitssysteme, nach zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit im Oktober 2024 eine erweiterte strategische Partnerschaft bekannt, um die Schiffahrtsbranche mit innovativen, umweltfreundlichen und kosteneffizienten Technologien zu verändern. Die Partnerschaft, die sich auf die Entwicklung und Nachrüstung von Elektrofähren und anderen emissionsfreien Schiffen konzentrieren wird, macht EPTechnologies zu einem der größten Anbieter von elektrischen Antriebssystemen in den USA.
Im September 2024 präsentieren Nathalie Paiva und Sam Payrovi, die Gründer von ArkHAUS, Pläne für einen neuen elektrischen Wassertaxi-Service mit der Bezeichnung Codename: E-Lixr, der dazu beitragen soll, die städtische Verkehrsbelastung in Miami zu verringern. ArkHAUS war 2022 als innovativer, schwimmender Club mit vier solarbetriebenen Yachten konzipiert worden, von denen die ersten beiden tatsächlich in Betrieb gehen.

(Grafik)
E-Lixr beabsichtigt, im Herbst dieses Jahres einen ,vor-elektrischen’ Pilotservice mit seinen Wassertaxis auf den Wasserstraßen der Biscayne Bay zu starten, beginnend mit zwei traditionellen Axopar-Booten namens Wanderlust und Stardust. Der landesweit erste vollelektrische Wassertransportdienst mit emissionsfreien E-Lixr-Schiffen, die im eigenen Haus entwickelt werden, soll im Folgejahr eingeführt werden. Bis auf einige hübsche Grafiken sind noch keine technischen Details bekanntgegeben worden.
Im Dezember ändert E-Lixr seine Geschäftsstrategie und versucht nun, ein landesweites und internationales Netz rein elektrischer Betreiber unter einer einzigen, wiedererkennbaren Marke zu schaffen. Tatsächlich betreibt das Unternehmen bislang allerdings nur einen privaten Transportdienst mit einem kleinen Wassertaxi für sechs Passagiere, das als ,vor-elektrisches Schiff’ bezeichnet wird...
Im August 2025 stellt der Trust for Governors
Island, eine von der Stadt New York gegründete gemeinnützige
Organisation, die für die Planung, den Betrieb und die laufende Entwicklung
von Governors Island zuständig ist, seine neueste Ergänzung der bestehenden
Fährflotte vor, eine 33 Mio. $ teure Hybrid-Elektrofähre namens Harbor
Charger. Sie wird die dieselbetriebene Lt. Samuel
S. Coursen ersetzen, die 1956 von der US-Armee
in Dienst gestellt wurde, seither ununterbrochen im Einsatz war und
später in diesem Jahr ausgemustert wird.

Die erste öffentliche Fähre mit Hybridelektroantrieb im Bundesstaat New York wurde von der EBDG entworfen und bietet Platz für bis zu 1.200 Passagiere und 30 Fahrzeuge. Ihre Ankunft fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum der Öffnung von Governors Island für die Öffentlichkeit zusammen, als ein grüner, sauberer und nachhaltiger Ort, den die New Yorker genießen können.
Der Harbor Charger ist mit dem diesel-elektrischen Antriebssystem BlueDrive Eco von Siemens Energy und der Batterielösung BlueVault und EcoMAIN ausgestattet. Damit kann er bis zu 66 % schneller fahren als die bisherigen Fähren. Die verbesserten Manövrierfähigkeiten beruhen auf Schottel-Azimut-Strahlrudern, die eine 360°-Steuerung ermöglichen. Um die landseitige Schnelladeinfrastruktur für die Fähre zu unterstützen, gibt es von der FTA einen Zuschuß in Höhe von 7,5 Mio. $.
In Deutschland wird im März 2017 berichtet, daß Michael Maul, Fährbesitzer und Vorsitzender des Deutschen Fähr-Verbandes, Deutschlands erste Rhein-Autofähre mit einem Diesel-Elektro-Antrieb ausstatten will, dessen Probebetrieb schon Anfang 2018 zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel beginnen könnte.

Die zu Ehren seines Vaters Horst genannte Fähre bringt bis zu 250 Passagiere und 32 Autos von einem Ufer zum anderen, was jährlich über 600.000 Personen und 300.000 Fahrzeugen entspricht. Den deutschen Rhein queren insgesamt rund 20 Autofähren.
Es gibt allerdings Vorläufer, denn schon 1908 querte eine elektrische Fähre den Rhein - über die bereits im ersten Teil dieser Chronologie ausführlich berichtet wurde.
Tatsächlich wird die Horst im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte mit modernen Assistenzsystemen, GPS, vier Voith-Schneider-Propellern und automatisierter Routensoftware ausgestattet, um den Betrieb zu digitalisieren und den Dieselverbrauch zu reduzieren. Die Pläne eines Hybridantriebs werden allerdings nicht verwirklicht.
So startet im August 2019 das mit 2,3 Mio. € geförderte Projekt ,Automatisierte und koordinierte Navigation von Binnenfähren’ (Akoon), das bis 2022 den Grundstein für autonome Fähren legen soll. An dem Projekt sind die RWTH Aachen, der Technologiekonzern J.M. Voith und das Softwareunternehmen Innovative Navigation beteiligt. Ihr Ziel ist es, eine vollautomatisierte Rheinfähre zu entwickeln, die sowohl die Pegelstände als auch die übrige Binnenschiffahrt in ihre Kalkulation einbezieht und sich so ihren Weg über den Rhein bahnt, dort selbständig anlegt und nach dem erneuten Beladen ihren Weg zurück aufnimmt.
Ebenfalls im März 2017 gibt die Innogy SE,
eine Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns RWE, bekannt,
daß sie ab dem Sommer auf dem Essener Baldeneysee ein Ausflugsschiff
mit klimaneutralen Methanol-Brennstoffzellen betreiben
will. Die Innogy hat dazu ein 29 m langes und 4,8 m breites Fahrgastschiff
für 180 Personen aus dem Jahr 2006 angekauft und läßt
dieses nun im Rahmen des Forschungsprogramms Pa-X-ell von
der Lux-Werft in Mondorf umbauen.

Die Energie für den Betrieb der MS innogy stammt vollständig aus regenerativen Quellen: Die Anlage zur Herstellung des Methanols steht in einem Container am Ufer des Baldeneysees in der Nähe des firmeneigenen Wasserkraftwerks. Sie entnimmt der Luft CO2, das zur elektro-biokatalytischen Methanolsynthese benötigt wird. Bei diesem Verfahren werden Enzyme mit Hilfe von Wasserkraftstrom angeregt, aus Wasser und Kohlendioxid Methanol herzustellen. Das System ist allerdings nicht effizient genug und die Anlage zu klein, so daß innogy Treibstoff aus Island zukaufen muß.
Das Methanol wird in den Brennstoffzellen an Bord des Schiffes zur Stromerzeugung genutzt und speist den mit zwei 50 kWh Akkus gepufferten elektrischen Propellermotor. Der Tankinhalt des Schiffes für Methanol beträgt 330 Liter. Das modulare 35 kW HT-PEM-Brennstoffzellen-System, bestehend aus sieben 5 kW Modulen, wird von der Firma SerEnergy A/S aus Aalborg, Dänemark, geliefert. Als Sicherheitsreserve gibt es einen 247 PS Volvo-Dieselmotor.
Die Gesamtkosten für Ankauf und Umbau belaufen sich auf rund 2 Mio. € und werden durch die Innogy SE sowie aus Fördermitteln der ,Grünen Hauptstadt Europas - Essen 2017’ finanziert. Betrieb und Wartung des Schiffes liegen anschließend bei der Weissen Flotte Baldeney GmbH. Diese zieht nach einem Jahr eine zufriedene Zwischenbilanz, denn nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft die Technik inzwischen störungsfrei. Und statt der anfangs kalkulierten vier Stunden kann das Schiff damit bis zu 14 Stunden angetrieben werden. Es ist für Chartertouren sehr gefragt, kommt in den Sommermonaten aber auch im Linienverkehr zum Einsatz.

Die MS innogy fährt ab August 2017 regelmäßig auf dem Essener Baldeneysee. Allerdings wird die innogy SE im Rahmen eines umfangreichen Tauschgeschäfts zwischen RWE und E.ON im Jahr 2018 zu einem Teil von E.ON. Nach dem Abschluß des Forschungsprojekts wird der Methanolbetrieb eingestellt.
Und auch hier läßt sich gewissermaßen ein Vorläufer finden, denn von 2008 bis 2011 wurde in Hamburg im Rahmen des Forschungsprojekts e4ships mit Beteiligung der MEYER WERFT und thyssenkrupp Marine Systems ein Brennstoffzellenschiff erbaut und praktisch erprobt, um diese umweltfreundliche Energieversorgung auf Schiffen zu demonstrieren. Die Geschichte geht aber weiter.
Nachdem im September 2021 Mittel in Höhe von rund 1,2 Mio. € aus dem Programm zur Förderung der Elektromobilität des Bundes bewilligt werden, sowie im November ein Gesellschaftsdarlehen des Rats der Stadt Essen in Höhe von rund 1 Mio. €, wird das inzwischen MS Westenergie genannte Schiff auf Batteriebetrieb umgerüstet, gemeinsam mit der MS Stadt Essen als zweites Schiff der Weissen Flotte.
Die MS Stadt Essen wurde bereits 1986 gebaut und ist mit 38,5 m sowie einer Passagierkapazität von 108 Gästen im Salon sowie 120 Passagieren auf dem Freideck etwas größer. Angaben zu den E-Antrieben macht der Betreiber nicht. Auch die bereits 1979 gebaute und 38 m lange MS Baldeney soll demnächst elektrifiziert werden.

Weiße Flotte GmbH
Im Juli 2017 wird von der Formstaal GmbH & Co.
KG in Stralsund ein neu gebautes Elektro-Solar-Fahrgastschiff zu Wasser
gelassen. Der 18,5 m lange und 5,22 m breite Aluminium-Katamaran war
von der lokalen Reederei Weiße Flotte GmbH geordert
worden und ist für 60 Personen zugelassen. Das Schiff, das mit 52 Solarmodulen
mit einer Gesamtleistung von 12 kW ausgestattet ist, erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h, während die Dienstgeschwindigkeit
8 km/h beträgt.
Das neueste Elektro-Solarschiff der Weißen Flotte wird nun nach der seeseitigen technischen Erprobung abgeliefert, um künftig auf dem Mittellandkanal eingesetzt zu werden. Über die Solarfähren, die von der Weißen Flotte betrieben werden und seit Januar 2014 unter dem Namen FährBär im Netz der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren, wurde bereits in einer früheren Übersicht berichtet (s.d.).
Im August 2017 wird über das Konzept Neptun
Hopper des deutschen Schiffsdesignbüros Neptun
Ship Design GmbH (NSD) berichtet, das plant, die durch den
innerstädtischen Pendlerverkehr beanspruchte Umwelt der Hansestadt
Rostock zu entlasten, indem als Ergänzung zum bestehenden öffentlichen
Personennahverkehr zukünftig beidseitig des Flusses Warnow auch zwei
vollelektrische Fähren zum Einsatz kommen. Damit sollen der Rostocker
Verkehr entzerrt und Passagiere klimaneutral transportiert werden.

(Grafik)
Das Konzept, mit dem NSD auf die Stadt zuging, sieht vor, die geographische Lage an der Warnowmündung strategisch zu nutzen, um den Einwohnern zu ermöglichen, mit den Elektrofähren alle Stadtteile flußkreuzend zu erreichen und den Oberwarnowbereich bis Schwaan naturschonend zu befahren. Um den Plan umzusetzen, soll ein Netz aus Anlegern rund um die Warnow entstehen, an denen die Fähren anlegen können. Vorgesehen ist auch die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwägen und Rollstühlen.
Für die Stromversorgung der beiden Schiffe, die aus alternativen Quellen sichergestellt werden soll, sowie deren Antriebs– und Ladeeinrichtung setzt NSD auf Siemens. Hierzu gehören Siship EcoProp-Elektroantriebe, deren Lithium–Ionen–Batterien sowohl über Solarpaneele auf dem Dach des Schiffes als auch während des Anlegens mittels Landeanschluß an den Anlegern aufgeladen werden. Als technologisches Vorbild für die Neptun Hopper dient die o.e. Ampere in Norwegen.
Projekt wird jedoch nie umgesetzt und schon im Januar 2019 wird die NSD von der MV Werften Holding Ltd. übernommen. Ab Ende 2020 wird unter deren Dach das öffentlich geförderte Projekt AmmoniaMot verfolgt, bei dem regenerativ erzeugtes Ammoniak als ,Kraftstoff der Zukunft’ für Marine-Verbrennungsmotoren propagiert wird, was hier aber nicht weiter verfolgt werden soll.

Im November 2017 wird auf der Mosel zwischen Deutschland
und Luxemburg die elektrisch betriebene Fähre Sankta Maria
II in Dienst gestellt, die als die „weltweit erste
vollelektrische Autofähre für Binnengewässer“ bezeichnet wird
und nun die alte Fähre Sankta Maria ersetzt, die jährlich etwa 14.000
Liter Dieselkraftstoff verbrauchte. Das neue Schiff kostet rund 1,5
Mio. €, Eignerin ist die Gemeinde Oberbillig.
Die von der Formstaal GmbH & Co. KG (später: Ostseestaal GmbH & Co. KG) in Stralsund gebaute Fähre hat eine Länge von 28 und ist 8,60 m breit. Das Deck ist für sechs Personenwagen sowie 45 Personen und 25 Fahrräder ausgelegt. Der Antrieb erfolgt mit vier elektrisch angetriebenen Ruderpropellern von je 20 kW, wobei der zum Antrieb benötigte Strom aus Akkus kommt, die für 13 Stunden Fährbetrieb plus weitere 13 Stunden als Sicherheit ausgelegt sind und über Nacht mit Landstrom im Laufe von etwas sechs Stunden aufgeladen werden.
Die an Bord verbauten 15 Solarmodule erzeugen zusammen 5,4 kW, die aber ausschließlich für Beleuchtung, Funk, Klimaanlage usw. genutzt werden.
Im Juli 2018 startet das EU-Innovationsprojekt HySeas
III mit einem Budget von etwa 12,6 Mio. € (andere Quellen:
gut 10,8 Mio. €), von denen knapp 9,3 Mio. € (andere Quellen: gut 7,8
Mio. €) von der EU getragen werden. Das Projekt zielt darauf ab, unter
dem Arbeitstitel Nautilus die weltweit erste hochseetaugliche
Autofähre mit Brennstoffzellen-Wasserstoffantrieb zu entwickeln, zu
bauen und zu testen. Die Partner sind acht Organisationen aus den sechs
Ländern Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Norwegen und Großbritannien.
Während das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu erneuerbaren Energielösungen forscht und Interferry (Belgien/USA) für die Beratung und Kommunikation zuständig ist, entwickelt die Ballard Power Systems Europe (Dänemark) die Brennstoffzellenmodule. Die Integration der Wasserstoffsysteme übernimmt McPhy Energy (Frankreich), die Entwicklung der maritimen Antriebstechnik die Firma Kongsberg Maritime (Norwegen) und die britischen Partner Ferguson Marine Engineering Ltd., die University of St Andrews und das Orkney Islands Council sind für Schiffsentwurf und Bau, für die Projektadministration und akademische Analyse sowie für den Betrieb, die Hafeninfrastruktur und die Erprobung der Fähre zuständig.
HySeas III durchläuft bis 2020 die Phasen von Antriebstests und Schiffsentwurf, gefolgt vom Baustart und detaillierten Tests des modularen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebsstrangs mit einer Leistung von ca. 1 MW sowie anderer Komponenten ab dem Folgejahr. Dabei wird das neue Fährdesign als hochseetaugliche Doppelendfähre für den Personen- und Fahrzeugverkehr zwischen den schottischen Orkneyinseln Kirkwall und Shapinsay ausgearbeitet.
Die Wasserstoffähre soll etwa 120 Passagiere und 16 Autos oder zwei Lastwagen befördern können. Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant, verzögert sich aber durch technische Herausforderungen. Dem aktuellen Stand zufolge wird das Projekt, das eigentlich im Juni 2022 enden sollte, nun voraussichtlich 2024/2025 abgeschlossen.
Im November 2018 erteilt die Generaldirektion
Wasserstraßen und Schiffahrt des Bundes (wsv.de) in Bonn der
Werft Baltic Workboats AS in Estland einen Auftrag
in Höhe von rund 21 Mio. € für drei neue Fähren für den Nord-Ostsee-Kanal
(NOK), welche die ältesten drei der dort eingesetzten 16 Fähren ersetzen
sollen: die Nobiskrug, Baujahr 1952, sowie
die Hochdonn und die Audorf, beide Baujahr 1953.
Die drei neuen dieselelektrischen Hybrid-Kanalfähren mit einer Länge von 30 m und einer Breite von 9,5 m werden mit batterieversorgten Elektroantrieben ausgestattet, bei denen die Batterien sowohl von einem Dieselgenerator an Bord als auch mit einem automatisierten Landanschluß aufgeladen werden können. Die Leistung der zwei Antriebsmotoren mit Zykloidal-Propellern beträgt jeweils 140 kW, was eine Geschwindigkeit von 13 km/h erlaubt. Der Generatordiesel hat eine Dauerleistung von 257 kW. Die Fähren haben zwei je 24 m lange Fahrspuren mit einer Breite von 2,85 m. Für die Passagiere gibt es einen 17 m langen überdachten Fußgängerbereich.
Die Fähren werden im Oktober 2021 auf die Namen Arlau, Alster und Stecknitz getauft, die sich auf schleswig-holsteinische Flußläufe beziehen. Nach ihrer Erprobung im Einsatz ist vorgesehen, mittel- bis langfristig die gesamte Flotte von insgesamt 16 Kanalfähren zu ersetzen.

(Grafik)
Im Januar 2020 fällt der Startschuß für das Innovationsnetzwerk Clean
Autonomous Public Transport Network (CAPTN), das sich - basierend
auf vorangegangenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Region
Kiel - zum Ziel gesetzt hat, eine autonome und klimaneutrale Mobilitätskette
zu schaffen, die verschiedene Verkehrsträger verknüpft und modernisiert,
mit Fokus auf die Fördeschiffahrt, Bus und Bahn, autonome Shuttles,
Fahrräder und Fußverkehr.
Hinter CAPTN stehen zahlreiche Partner, darunter die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die Fachhochschule Kiel, das Wissenschaftszentrum Kiel, lokale Unternehmen sowie internationale Branchenteilnehmer aus Schiffahrt, Energietechnik, Infrastruktur, KI und Digitalisierung. Gefördert wird das Netzwerk aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln in Höhe von rund 15 Mio. €; für den CAPTN-Energy-Zweig der zweiten Förderphase von 2023 bis 2028 stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 12 Mio. € zur Verfügung.
Im Mittelpunkt stehen der Bau und der Betrieb autonomer, vollelektrischer Forschungsfähren in Kiel. Dazu zählt ein 21 m langer Katamaran, der auf einem speziell gesicherten, digitalen Testfeld verkehrt, um autonome Navigation sowie Lade- und Kommunikationsinfrastruktur zu demonstrieren. Mehr über autonome Schiffe findet sich in einem späteren Schwerpunkt.
Im November 2021 gibt die Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (FuE-GmbH) bekannt, daß die Forschungsplattform Wavelab im Rahmen des von der Fachhochschule umgesetzten und koordinierten Projektes CAPTN nun von der Gebr. Friedrich Schiffswerft in Kiel gebaut wird. Die Forschungsplattform in Form eines Katamarans wird aus Aluminium bestehen und ca. 20 m lang und 8 m breit sein. Darüber wurde bereits bei der Darstellung der Firma Torqeedo in der Übersicht 2011 berichtet (s.d.).
Kooperationspartner der CAPTN-Initiative sind die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sowie die Unternehmen ADDIX GmbH, Raytheon Anschütz GmbH und das Wissenschaftszentrum Kiel GmbH. Im Oktober 2022 wird allerdings berichtet, daß zwischenzeitlich ca. 50 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Interesse an einer Mitwirkung bei CAPTN Energy gezeigt haben.
Mitte Mai 2020 erfolgt auf der Bauwerft Holland
Shipyards in den Niederlanden der Stapelhub des ersten Plug-in-Hybridschiffs
der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK),
die den Bauauftrag dafür im November 2018 unterzeichnet
hatte. Die SFK, ein Tochterunternehmen des Eigenbetriebs Beteiligungen
der Landeshauptstadt Kiel (EBK), besitzt zehn Fahrgastschiffe auf zwei
Fährlinien, sechs Schlepper und zwei Seepontons - und hatte ein Modernisierungsprogramm
mit einem Volumen von rund 16 Mio. € gestartet.

Die Taufe als MS Gaarden erfolgt im Juli 2020, der reguläre Linienbetrieb auf der Kieler Förde wird im August aufgenommen. Das Schiff, dessen Baukosten von rund 3,9 Mio. € (andere Quellen: 4,5 Mio. €) durch Fördermittel des Bundes im Rahmen des ,Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020’ unterstützt wurden, ist 32,56 m lang, 8,94 m breit und befördert barrierefrei 300 Fahrgäste und 40 Fahrräder.
Der Antrieb besteht aus zwei elektrischen Fahrmotoren mit je 255 kW, die Batteriekapazität beträgt 273 kWh (spätere Werftangabe: 340 kWh). Die Batterien laden per Landstrom, zur Reichweitenverlängerung besitzt die Fähre zwei GTL-Generatorgregate mit je 305 kW.
Insgesamt unterstützt Berlin die SFK mit 3,2 Mio. € – jedoch für das gesamte Projekt, also auch die drei weiteren Hybridfähren, die E-Fähre sowie die komplette Ladeinfrastruktur für die Schiffe, mit deren Lieferung die Dinslakener Schaltbau-Tochter SBRS GmbH beauftragt wird, die u.a. an fünf Ladepunkten Hochleistungsschnelladestationen einrichtet.

Als Nächstes folgt mit der MS Düsternbrook die erste vollelektrische Fähre, die bereits im April 2020 bei Holland Shipyards auf Kiel gelegt und im Dezember nach Kiel überführt wurde. Die Taufe des 24,7 m langen und 7,2 m breiten Elektroschiffes, das im Vergleich zu den Hybridfähren relativ klein wirkt, findet im Mai 2021 statt, die Inbetriebnahme auf der Schwentine-Linie F2 im Juni. Der Bau des knapp 3 Mio. € teuren Schiffes wurde durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit rund 400.000 € gefördert.
Auf dem Vorschiff der Düsternbrook haben bis zu 60 Fahrräder Platz, im hinteren Bereich können 140 Passagiere vom West- zum Ostufer der Förde befördert werden. Der Antrieb erfolgt über zwei je 86 kW Elektromotoren und ein Bugstrahlgerät mit 40 kW, die Speicherkapazität der Batteriepakete liegt bei 819 kWh. Zudem sind auf dem Dach des Decks 20 PV-Paneele installiert, die das Stromnetz an Bord versorgen.
Die Modernisierung der SFK-Flotte geht mit zwei Plug-in-Hybridschiffen weiter: der Personenfähre MS Friedrichsort, die bereits im März 2021 auf Kiel gelegt wurde und im März 2022 getauft wird, sowie der MS Wik, die im Mai 2021 auf Kiel gelegt wird und deren Taufe im Juni 2022 erfolgt. Die beiden baugleichen Schiffe unterscheiden sich in Details von der Gaarden, sie sind z.B. 1,09 m länger, haben aber die gleiche Kapazität an Fahrgästen.

Die MS Friedrichsort, deren Baukosten bei rund 4 Mio. € liegen, wobei das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 40 % der Mehrkosten für die elektrischen Antriebskomponenten trägt, ist nun auf der Fördefährlinie F1 unterwegs. Außerdem wird die SBRS GmbH im Jahr 2022 von der Shell Deutschland GmbH übernommen.
Im weiteren Verlauf des Modernisierungsprogramms folgt die vollelektrische Fähre MS Wellingdorf, deren Taufe im August 2022 stattfindet. Sie gleicht weitgehend der Düsternbrook, hat aber eine vergrößerte Akkukapazität von 1.092 kWh und geänderte Landebretter. Dank des geteilten Batteriesystems der niederländischen EST-Floattech verfügt das Schiff über Redundanzen und benötigt keine Notstromversorgung durch einen Dieselmotor. Darüber hinaus verfügt die Wellingdorf über ein automatisiertes, elektrohydraulisches Anlegesystem.
Das vierte Plug-in-Hybrid-Schiff wird im November 2022 auf Kiel gelegt und sollte den Namen Schilksee bekommen, wird im Dezember 2023 aber als MS Laboe getauft. Die Kiellegung für die dritte E-Fähre findet bei Holland Shipyards im Januar 2023 statt, ihre Taufe auf den Namen MS Dietrichsdorf erfolgt im April 2024.
Im September 2020 wird bei der Ostseestaal GmbH & Co.
KG eine neue hochmoderne Elektro-Solar-Personenfähre auf Kiel gelegt.
Auftraggeber für den Bau des vollelektrischen Katamarans ist die Stadt
Rostock, wo die Fähre ab Oktober 2021 auf
einer Strecke von einem halben Kilometer zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf
im Rostocker Stadthafen pendeln und eine schnelle und zuverlässige
Verbindung der städtischen Bereiche östlich und westlich der Warnow
bieten soll.

Der Rumpf des 19,9 m langen und 6,60 m breiten Katamarans, der bis zu 80 Personen und 15 Fahrräder befördert, ist aus Stahl gefertigt, den Antriebsstrom für die zwei 45 kW Ruderpropeller liefern 230 kWh Hochleistungsbatterien, welche von 36 auf dem Dach des Schiffes installierten PV-Paneelen mit 10,8 kW geladen werden. Der von dem Schwesterunternehmen Ampereship GmbH designte Katamaran erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h, wobei für die Realisierung des Fahrplanes eine Dienstgeschwindigkeit von 7 - 8 km/h ausreichend ist, denn die Warnowstromer genannte Elektrofähre der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) ist ausschließlich für den Hafenverkehr vorgesehen. Allerdings fällt das 1,7 Mio. € teure Schiff immer wieder wegen technischer Probleme aus.
Im Februar 2025 wird berichtet, daß die Fähre im Rahmen eines Forschungsprojekts mit Meß- und Rechnertechnik ausgestattet werden soll, um das autonome Fahren auf dem Wasser zu erproben. Gemeinsam mit dem Institut für Automatisierungstechnik der Universität Rostock hatte die RSAG entsprechende Fördermittel der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen in Höhe von rund 1,3 Mio. € eingeworben. Nach einer Vorbereitungsphase startet das Projekt Warnowstromer AI offiziell im April und läuft bis Ende Dezember 2027. Mehr über die verschiedenen Ansätze zur Automatisierung im Wasserverkehr findet sich in einem späteren Schwerpunkt.
Ebenfalls im September 2020 bestellt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) eine neue Elektro-Solarfähre für die Schlei zwischen Missunde und Brodersby zur Ablösung der alten dieselbetriebenen Fähre Missunde II.
Eine Machbarkeitsstudie im Auftrag der Landesregierung, die 106.000 € kostete, hatte 2019 der Dieselfähre, die seit 2003 betrieben wird, einen „überdurchschnittlich schlechten Zustand“ attestiert. Eine Sanierung, so das beauftragte Konstruktionsbüro Buchloh aus Rheinland-Pfalz, wäre gegenüber der Errichtung eines neuen Schiffs jedoch unwirtschaftlich, denn beides lasse Kosten von etwa 1,7 Mio. € erwarten. Das Büro wird daher mit der Planung einer neuen Fähre zwischen den Orten Missunde und Brodersby-Goltoft beauftragt.

Ein Jahr später entwickelt es gemeinsam mit dem Land ein noch ehrgeizigeres Projekt. Die neue Grundseilfähre Missunde III soll demnach vollelektrisch und mit Solardach ausgestattet sein - und mit einer Länge von 31 m und einer Breite von 8,80 m doppelt so groß wie ihre Vorgängerin, damit sie sogar Reisebusse und Landmaschinen über die Schlei bringen kann. Derzeit befördert die Missunde-Fähre jährlich bis zu 120.000 Pkw und 50.000 Fahrräder, und dem Fahrpächter zufolge besteht nur wenig Nachfrage nach dem Transport größerer Fahrzeuge.
Im März 2021 ist die größere Fähre beschlossene Sache, das wirtschaftlichste Angebot für 3,3 Mio. € kommt von der Schiffswerft Hermann Barthel GmbH. Da die Fährerlaubnis für die Missunde II im Oktober 2022 ablaufen würde, sollte das neue Schiff zu diesem Zeitpunkt fertig sein, doch mehrere Faktoren verzögern die rechtzeitige Inbetriebnahme. Erst dauert der Umbau der Rampen länger als geplant, dann spielte das Wetter nicht mit – und aufgrund des Ukraine-Kriegs sind bestimmte elektrische Komponenten nicht lieferbar.
Die Testfahrten der Missunde III können daher erst Anfang 2024 beginnen. Dabei stellt sich heraus, daß es insbesondere bei starkem Wind und starker Strömung Probleme beim Anlanden gibt, weshalb die Fähre einen breiteren Anleger braucht, der zusätzliche Kosten von rund 100.000 € verursacht. Dennoch findet im Januar die Schiffstaufe statt – und bis Mitte März will man die Fähre in Dienst stellen, während die Missunde II im Februar für 17.000 € an einen dänischen Interessenten verkauft wird.
Trotz Optimierung der Rampen und Anlegestellen bleiben die Anlegeprobleme der Fähre bei Windstärken von 3 aufwärts erhalten, so daß bereits von Konstruktionsfehlern geredet wird. Im April kauft das Land infolge öffentlichen Drucks die Missunde II für vorerst 50.000 € zurück. Außerdem soll ab Herbst für den Fall, daß man das Schiff weiterhin benötigen würde, eine monatliche Miete von 5.000 € anfallen. Aufgrund der notwendigen Umbauarbeiten bei dem neuen Schiff verlängert der Bund die Betriebserlaubnis für die Missunde II bis 2028.
Die Kosten für Missunde III übersteigen derweil den ursprünglich kalkulierten Wert um 700.000 €. Wer für das Debakel die Verantwortung trägt, will das Wirtschaftsministerium nun rechtlich prüfen lassen, denn es besteht der Verdacht, die Politik habe aus ideologischen Gründen eine funktionstüchtige Fähre durch ein ,klimaneutrales’, aber nicht einsatzfähiges Prestigeprojekt ersetzt.
Im April 2024 kündigt der LKN.SH an, daß die neue Elektrofähre voraussichtlich Ende September einsatzbereit sein wird, doch die aufwendigen Umbauarbeiten – unter anderem an der Seilführung und an den Rampen auf beiden Uferseiten – sowie der Einbau von Zusatzbatterien und zwei Querstrahlrudern auf der Kieler German Naval Yards Werft zur Optimierung der Manövrierfähigkeit dauern bis Sommer 2025 an. Andere Quellen berichten, daß der Umbau tatsächlich erst im September 2025 beginnt. Der Einsatz ist dann ab April 2026 vorgesehen.
Im Juni 2021 bestellen die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB)
bei der Stahlverarbeitungsfirma Ostseestaal GmbH & Co.
KG in Stralsund eine 33 m lange und 9 m breite Katamaran-Personenfähre,
die nicht nur über einen vollelektrischen Antrieb aus zwei 75 kW Elektromotoren
verfügen wird, sondern auch über bifaziale Solarmodule auf dem Freideck.
Das von dem Unternehmen Ampereship, einer Tochtergesellschaft
von Ostseestaal, entworfene Schiff mit dem Projektnamen Artemis soll
bereits im Folgejahr fertig sein.

Insel Mainau
Die Ostseestaal, die bis Februar 2018 als Formstaal GmbH & Co. KG firmierte und zur niederländischen Central Industry Group gehört, hat seit 2012 bereits zehn Elektro-Solar-Schiffe ausgeliefert, die allerdings deutlich kleiner waren – etwa die o.e. Sankta Maria II oder die weiter unten genannte Antonia vom Kamp, über die auch schon in der Präsentation der deutschen Firma Torqeedo berichtet wurde (siehe Übersicht 2011).
Der Platz an Bord der Fähre ist für 300 Personen sowie 18 Fahrräder zugelassen, die Kapazität der Lithium-Polymer-Akkus wird den Planungen zufolge bei 960 kWh liegen und die Geschwindigkeit soll bis zu 17 Knoten betragen. Die bifazialen Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 20 kW sind auf einer Fläche von 134 m2 auf dem Dach über dem oberen Passagierdeck sowie an den Seiten des Schiffes angebracht. Zu den weiteren Besonderheiten des Energiekonzepts zählen eine speziell entwickelte Steuerungs- und Optimierungssoftware sowie ein Magnet-Anlegesystem.
Das Schiff wird im Juni 2022 auf den Namen Insel Mainau getauft und verkehrt seit September auf dem Überlinger See im Kursverkehr zwischen Unteruhldingen und der Insel Mainau. Der Bau kostete 3,6 Mio. € und wurde von der Bundesrepublik Deutschland mit 300.000 € gefördert. Wenn sich das Design und die Technik bewähren, könnte der BSB zufolge bis 2025 ein Schwesterschiff gebaut werden.
Die Insel Mainau absolviert übrigens im Juli 2025 einen spektakulären Reichweitentest, als sie bei einer 19-stündigen Dauerfahrt exakt 211,3 km rein elektrisch zurücklegt - bei einer verbleibenden Restkapazität von 20 % in den Batterien.

Im August 2021 erfolgt zudem die Taufe und Indienststellung einer von Ostseestaal gebauten vollelektrischen Solarfähre auf den Namen Antonia vom Kamp, die für den Einsatz zwischen Kamp auf dem Festland und Karnin auf der Insel Usedom vorgesehen ist und dort eine konventionelle Passagierfähre ersetzt. Der 14,65 m lange und 4,5 m breite Katamaran der Auftraggeberin Oderhaff Reederei Peters GmbH & Co. KG in Ueckermünde kann pro Fahrt bis zu 20 Personen und 15 Fahrräder befördern.
Für den emissionsfreien Betrieb des 60 kW Ruderpropellers sorgen 4,3 kW Solarmodule und 80 kWh Hochleistungsbatterien, die der Fähre eine Dienstgeschwindigkeit von 8 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 15 km/h erlauben.
An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß es bei den Stadtwerken Konstanz bereits Anfang 2013 Pläne für eine elektrisch betriebene Autofähre auf dem Bodensee gab. Die im Jahr 2004 in Betrieb genommene und mit Dieselmotoren ausgestattete Tábor sollte die erste mit Ökostrom betriebene Fähre zwischen Konstanz und Meersburg werden, doch das Vorzeige-Klimaschutzprojekt scheiterte.
Zwar wurden bis 2015 Vorstudien durchgeführt und Förderanträge gestellt und es wurden auch Fördermittel für den Umbau und den Ausbau der Ladeinfrastruktur versprochen, doch diese wurden von den Stadtwerken nie beantragt - und das Projekt schläft ein. Erst im Jahr 2025 wird wieder davon gesprochen, die Tábor zu einem elektrisch betriebenen Fährschiff umzubauen. Förderanträge wurden bereits gestellt.
Hierzu paßt, daß Studenten der HTWG - Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung auf Anregung der Stadtwerke bereits 2021 ein Konzept dafür entwickeln, wie das Aufladen der Bodensee-Autofähren per Induktion über die Fährbrücke erfolgen kann. Das induktive Ladesystem soll zunächst an dem mit einem Photovoltaik-Wasserstoff-Hybridantrieb ausgestatteten HTWG-Forschungsschiff Solgenia erprobt werden, das bereits in der Übersicht 2007 aufgeführt ist.

Im Mai 2022 geht auf dem Rhein die A-ROSA
SENA auf Jungfernfahrt, ein ,E-Motion Ship’ der deutschen
Reederei A-ROSA Flussschiff GmbH mit Sitz in Rostock,
das mit einem Hybrid-Batterieantrieb ausgestattet ist. Mit fünf Decks
und einer Breite von fast 18 m ist sie deutlich größer als die üblichen
Flußkreuzfahrtschiffe in Europa.
Die A-ROSA SENA kann bis zu 280 Gäste aufnehmen, die viel Platz vorfinden: Die Standard-Kabinen haben alle einen Balkon und sind 21 m2 groß, und die Familienkabinen kommen sogar auf 28 m2. Auf demselben Deck wie die Familienkabinen befindet sich ein großer Kids Club, ansonsten lockt ein Wellneß-Bereich mit großem Ruheraum, Fitneßraum sowie Saunabereich.
In der aktuellen Saison ist die A-ROSA SENA ausschließlich in Holland und Belgien unterwegs und steuert dabei Städte wie Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen an. Die Vermarktung der Reisen läuft im Rahmen von A-ROSA Kreuzfahrten als Marke bzw. Vertriebskanal.

Im Juni 2022 wird das elektrisch betriebene Fahrgastschiff Möwe der Stadtwerke Haltern am See, gebaut in der Lux-Werft am Rhein bei Bonn, auf dem Stausee Haltern in Betrieb genommen, anderen Quellen zufolge aber erst im März 2023. Das 36 m lange Schiff, das Platz für bis zu 270 Fahrgäste bietet und pro Tag fünf Linienfahrten durchführt, hat eine Stromspeicherleistung von 1.024 kWh und wird nachts ausschließlich mit Ökostrom geladen, der durch PV-Paneele auf dem Schiffsdach ergänzt wird. Diesen Strom können auch die Fahrgäste nutzen: Für E-Bikes gibt es Lademöglichkeiten an Bord.
Das neue Flaggschiff der Stadtwerke ist von einem Projektteam mit Mitarbeitern aus allen Abteilungen geplant worden und ersetzt das noch mit Palmöl betriebene Vorgängermodell. Als Belohnung gewinnen die Stadtwerke im Juni 2024 den NachhaltigkeitsAWARD Mobilität der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) in Bronze.

Im Juli 2022 bestellt die stadteigene Hamburger Verkehrsgesellschaft
und Reederei HADAG, Betreiberin der Hafenfähren seit 1888 und
Tochter der Hamburger Hochbahn AG, drei Plug-in-Hybridfähren, die von
der SET Schiffbau- u. Entwicklungsgesellschaft Tangermünde
mbH in Sachsen-Anhalt gebaut werden sollen und deren Preis
bei 8,5 Mio. liegt. Die erste Fähre soll 2024 ausgeliefert
werden, die anderen beiden Exemplare vor dem Jahreswechsel 2024/2025.
Der Vertrag zwischen den Partnern - der allerdings erst im Oktober 2025 unterzeichnet wird - sieht darüber hinaus eine Option auf drei weitere Fähren vor.
Die Neuland, die Finkenwerder und die Grasbrook sind jeweils 33 m lang und bieten Platz für 250 Personen. Sie sind mit 616 kWh Batterien sowie Dieselgeneratoren ausgestattet, so daß sie überwiegend elektrisch fahren und die Reichweite durch den Dieselbetrieb erweitert werden kann.

Die seriellen Hybrid-Antriebssysteme liefert Danfoss Editron. Diese umfassen u.a. einen Scania-Dieselmotor, einen Generator von Editron, zwei elektrische Propeller von Voith sowie einen Batteriespeicher. Von der Option, stattdessen ein Brennstoffzellen-Antriebssystem zu integrieren, war man allerdings abgerückt.
Tatsächlich wird die Neuland im März 2024 zu Wasser gelassen und im September getauft; die Finkenwerder geht im November in Dienst; und die Grasbrook beginnt als dritte Fähre im Juli 2025 ihren Betrieb auf der Elbe. Durch die drei neuen Hybridfähren wächst die HADAG-Flotte auf der Elbe auf 29 Schiffe an. Die Fähren sind ein fester Bestandteil des Hamburger ÖPNV: Sie verkehren auf acht Routen mit 20 Anlegestellen und befördern jährlich rund 9 Mio. Fahrgäste.
Nachdem die entsprechende Verordnung im November 2023 in Kraft tritt, werden ab 2025 nur noch emissionsfreie Schiffe mit Elektroantrieb eine Erlaubnis erhalten, um die Hamburger Alster befahren. Aktuell besitzen knapp 240 Schiffe mit Verbrennungsmotor eine Genehmigung; allerdings gibt es auch schon 46 Erlaubnisse für Boote mit Elektroantrieb.

In diesem Zusammenhang gibt die ATG Alster-Touristik bekannt, daß sie nun auch ihr 22 m langes Fahrgastschiff Eilbek auf vollelektrischen Antrieb umrüstet, das seit 1952 auf der Alster fährt, Platz für 80 Fahrgäste bietet und das zweitälteste Schiff der ATG-Flotte ist. Der neue Elektromotor besitzt eine Leistung von 100 kW und wird von sechs Lithium-Ionen-Batterien mit jeweils 40 kWh versorgt, die in feuerfesten Stahlschränken untergebracht sind und bis zu zehn Betriebsstunden erlauben, ohne daß tagsüber eine Nachladung erforderlich ist. Der Umbau, der mit Bundesmitteln in Höhe von 600.000 € gefördert wird, erfordert insgesamt rund 1 Mio. €.
Zusammen mit der Alstersonne, die als der weltweit größter PV-betriebener Katamaran im Jahr 2000 in Dienst ging (s.d.), und der im August 2008 in Betrieb genommenen Alsterwasser, können die Fahrgäste der ATG nach Abschluß dieses Umbauprojektes bereits drei Schiffe mit vollständig emissionsfreien Antrieben nutzen.
Die Alsterwasser mit einer Länge von 25,56 m, einer Breite von 5,2 m und einer Kapazität von ca. 100 Passagieren war Ergebnis des EU-Forschungsprojekts Zero Emissions Ships (ZEMShips) und galt als die weltweit erste Passagierfähre mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb. Ihr Antrieb bestand aus zwei 48 kW Proton-Exchange-Membran (PEM)-Brennstoffzellen, sieben Blei-Gel-Akkus als Speicher, einem 100 kW Drehstrom-Elektromotor sowie einem 20 kW Bugstrahlruder. Die Wasserstofftanks faßten insgesamt etwa 50 kg Wasserstoff bei einem Druck von 350 bar.
Im Jahr 2010 kam es während der Probefahrten zu einem Brand im Batterieraum, der aber keinen Wasserstoffunfall verursachte, so daß das Schiff schon im Folgejahr wieder eingesetzt werden konnte. Als die Wasserstofftankstelle aus wirtschaftlichen Gründen jedoch 2014 geschlossen wird, wird auch der Betrieb der Brennstoffzellen-Fähre eingestellt. Seitdem fährt das barrierefrei ausgestattete Schiff ausschließlich batterieelektrisch.
Bei zwei weiteren historischen Alsterschiffen laufen bereits die Planungen für den Elektroantrieb, nämlich für die Bredenbek und die Susebek. Zur Versorgung dieser und weiterer Schiffe wird am Jungfernstieg eine Ladeinfrastruktur aufgebaut.

Ab April 2024 verkehrt die erste vollelektrische Fähre im Sommerhalbjahr täglich auf der deutschen Ostsee zwischen Wismar und Kirchdorf auf der Insel Poel. Die Kapazität der 1.440 kWh Batterie reicht für sechs Fahrten auf der etwa 14 km und eine Stunde langen Strecke, wobei etwa 500 kWh Restmenge in den Batterien verbleiben. Zusätzlich zum Ladestrom aus dem Netz generieren Solarzellen auf dem Dach des Fahrgastschiffes 15 kW.
Die von der Lux-Werft am Rhein gebaute und 5 Mio. € teure MS Adler Nature, die als erste Ostsee-Elektrofähre außerhalb von Häfen gilt, ist 32 m lang und 9 m breit und bietet 250 Menschen und 50 Fahrrädern Platz. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 16 km/h. Betreiberin ist die Reederei Adler-Schiffe mit Hauptsitz in Westerland auf Sylt.
Im Januar 2025 übernimmt die AG Reederei Norden-Frisia das „erste
rein batterieelektrisch betriebene deutsche Seeschiff“, das im
Dezember 2022 bei der Damen Shipyards Group in
Auftrag gegeben worden war. Die Jungfernfahrt der Frisia
E-I, die als ein Pionierprojekt für emissionsfreie Seeschiffahrt
im deutschen Wattenmeer betrachtet wird, findet im März statt. Ab April
wird das Schiff im Fährbetrieb zwischen Norddeich und Norderney eingesetzt
und transportiert bis zu 150 Fahrgäste pro Fahrt, die Fahrtzeit beträgt
etwa 30 Minuten.

Die Fähre wird von zwei 600 kW Elektromotoren, deren Stromversorgung durch Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit einer Kapazität von 1,8 MWh erfolgt. Die Antriebe und Akkumulatorbänke sind jeweils in den beiden Schwimmkörpern des Katamarans untergebracht, wo sich auch zwei elektrisch angetriebene Bugstrahlruder mit je 75 kW Leistung befinden.
Zum Laden des Schiffes installiert der Anbieter von Ladesystemen Heliox die notwendige Infrastruktur in Norddeich in Form einer 2 MW Ladestation. Das Laden erfolgt dort während der Liegezeit. Die Reederei plant zudem einen autarken Betrieb der Fähre und installiert dafür PV-Anlagen auf überdachten Parkflächen und Gebäuden des Unternehmens, so daß der Betrieb der Fähre CO2-neutral erfolgen kann. Für die Zwischenspeicherung des erzeugten Stroms verfolgt die Reederei ein Projekt, in dem Altbatterien aus Elektroautos als Energiespeicher genutzt werden sollen.
Bei diesem ersten Test eines Multi-Megawatt-Ladesystems an der Nordsee sollen noch weitere Ziele umgesetzt werden, wie den Anschluß des Schiffes an das Ladesystem zu vereinfachen. In weniger als 30 Sekunden nach dem Anlegen soll die Fähre mit der Ladestation verbunden sein.
Das Projekt ist ein Pilot für weitere Ladepunkte für Fähren und Schiffe, die im Rahmen des europäischen Verbundprojekts Hyper powered vessel battery charging system (Hypobatt) entstehen, das 18 Hersteller und Forschungseinrichtungen in zehn europäischen Ländern vereint, um modulare Schiffsladegeräte mit einer Ladeleistung von mehreren Megawatt zu entwickeln und zu standardisieren.
Im Mai 2024 wird in Travemünde die von der Stralsunder
Werft Ostseestaal gebaute Elektrofähre Welt ahoi! getauft,
die von der Stadtverkehr Lübeck, einer Tochter der
örtlichen Stadtwerke, betrieben wird und zwischen Travemünde und der
Halbinsel Priwall fährt. Die Fähre verfügt über einen diesel-elektrischen
Hybridantrieb und wird etwa 50 % der Fahrzeit rein elektrisch betrieben.
Sie kann bis zu 250 Personen, 15 Fahrräder und 18 Pkw bzw. zwölf Pkw
plus zwei Lkw aufnehmen.
Allerdings gibt es bereits unmittelbar nach der Taufe technische Probleme, unter anderem einen Systemausfall und eine Kollision bei den Probefahrten, die den regulären Betrieb verzögern. Im September 2025 ist die Fähre noch nicht wieder im regulären Dienst, ein genauer Termin für den Neustart ist noch offen.
Ab Mai 2025 ist auf dem deutschen Rhein bei Niederkassel
die Konrad Adenauer als „erste vollelektrisch
betriebene Autofähre“ offiziell im Linienbetrieb unterwegs.

Auch in diesem Fall handelt es sich um einen Umbau: Zuvor waren innerhalb von fast neun Monaten die drei alten Dieselmotoren entfernt und stattdessen drei Elektromotoren mit je 190 PS installiert worden, die die vier Schrauben der Fähre antreiben.
Außerdem wurde die komplette Elektrik der im Jahr 1967 gebauten Fähre angepaßt und neben einer Klimatisierung auch eine spezielle Löschanlage für die mehr als 60 großen Akkus montiert, die sich auf zwei Räume im Bauch verteilen.
Die Fähre, die im Probebetrieb von Bonn Graurheindorf nach Niederkassel Mondorf übersetzt, bevor sie später zwischen Bonn Bad Godesberg und Königswinter Niederdollendorf zum Einsatz kommt, wird über Nacht mit Ökostrom geladen. Die Umrüstung, die gleichzeitig für eine komplette Renovierung genutzt wird, erhält eine staatliche Förderung in nicht genannter Höhe. Daneben laufen die Vorarbeiten für die Errichtung einer E-Tankstelle.
Für den Umbau verantwortlich und auch Betreiberin der Konrad Adenauer ist die lokale Lux-Werft, die bereits die Fähre Mondorf ebenfalls auf Stromantrieb umgerüstet hat, welche spätestens Anfang 2025 als zweite Elektrofähre auf dem Rhein in Betrieb gehen soll.
In Taiwan wird im Juni 2017 als Teil des Modernisierungs- und Nachhaltigkeitsprogramms für den öffentlichen Nahverkehr der Hafenstadt Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt des Landes, eine batteriebetriebene Fähre in Betrieb genommen und zur Überfahrt zwischen Kaohsiung und der Halbinsel Cijin eingesetzt. Diese Fähre gilt als erste vollständig elektrisch angetriebene Autofähre Asiens und befördert auf der rund 650 m langen Verbindung täglich 15.000 Passagiere.

Die als Ferry Happiness (o. Qi-Fu No. 1) bezeichnete Elektrofähre der lokalen Werft Ting Hai Shipbuilding Co. Ltd. ist 25,2 m lang, 6,5 m breit und bietet Platz für 150 Passagiere und 46 Motorroller oder Fahrräder. Bei der Umrüstung durch den Danfoss-Geschäftsbereich Danfoss Editron mit Sitz in Lappeenranta, Finnland, werden die zwei 300 PS starken Dieselmotoren durch zwei powerMELA-Elektromotoren mit je 150 kW der deutschen Firma Sensor-Technik Wiedemann GmbH (STW) ersetzt.
Zudem wird das Schiff mit drei parallel geschalteten Lithium-Ionen-Batteriebänken mit zusammen 250 kWh ausgestattet, die etwa vier Stunden rein elektrische Fahrt bei durchschnittlich 6 Knoten erlauben. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 9 Knoten, die Ladezeit etwa drei Stunden. Das Danfoss-System sorgt dafür, daß die Fähre während 50 % ihrer Betriebszeit rein elektrisch bei Dienstgeschwindigkeit fahren kann. Zur Redundanz und um die Reichweite zu erhöhen, falls es die Batteriekapazität erfordert, gibt es zwei 50 kW Diesel-Notstromaggregate. Ansonsten wird die Batterie über Landstrom geladen - unterstützt durch PV-Anlagen an Land und auf dem Schiff.
Nach dem Erfolg dieses Projekts plant die Stadtverwaltung von Kaohsiung, auch den Rest ihrer Dieselflotte nachzurüsten und so die Verschmutzung im größten Hafen Taiwans einzudämmen.
In der Schweiz beauftragt die Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN SA) zum Jahresbeginn 2020 das Schiffbauunternehmen Shiptec AG mit der Lieferung von zwei neuen Personenfähren für den Genfersee.

Die im September 2012 als Tochter der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) gegründete Shiptec mit Sitz in Luzern begann schon damals, konventionelle Schiffe in rein elektrische sowie dieselelektrische Hybridschiffe umzubauen. Das erste Schiff, das die Shiptec entwickelte und baute, war das Motorschiff MS Saphir, das als serielles Hybridschiff mit Dieselaggregaten und E-Motoren seitdem auf Rundfahrten im Luzerner Seebecken unterwegs ist.
Die ca. 6.5 Mio. SFr teure Panorama-Yacht, deren ästhetisches Erscheinungsbild dem Büro judel/vrolijk & co design + engineering in Bremerhaven zu verdanken ist, ist 49 m lang, 8,3 m breit und hat eine Personenkapazität im Kursbetrieb von 300 Personen. Seine Geschwindigkeit beträgt 28 km/h.
Ab 2013 konstruierte die Shiptec dann gemeinsam mit Ingenieuren der Hochschule Luzern ein Motorschiff für 1.000 Passagiere für die SGV, das als erstes Fahrgastschiff in Europa einen parallel-hybriden Antrieb enthält. Neben zwei Dieselmotoren von je 405 kW Leistung ist das Schiff mit zwei Elektromotoren mit je 180 kW Leistung sowie Batterien mit einer Gesamtkapazität von 84 kWh ausgestattet. Ihre Jungfernfahrt macht die 63,5 m lange und 13,5 m breite MS Diamant (anfangs: MS 2017) im Mai 2017.

Die SGV nimmt im Mai 2018 zudem das Motorschiff Bürgenstock in Betrieb, eine hochmoderne, etwa 6 Mio. SFr teure Fähre, die ebenfalls mit dem hybriden Antriebssystem von Shiptec/Siemens ausgestattet ist und als das erste klimaneutrale Kursschiff der Schweiz bezeichnet wird.
Die Bürgenstock ist ein 38 m langer und 10,3 m breiter Pendlerkatamaran mit zwei Decks für 300 Personen, dessen Hybridantrieb aus zwei elektrischen Motoren/Generatoren mit jeweils 180 kW Leistung sowie zwei 552 kW Dieselmotoren besteht. Die Aluminiumstruktur für die Fähre war von der polnischen Firma Aluship Technology in Danzig konstruiert und gebaut worden. Ihre nominale Kursgeschwindigkeit beträgt 17,8 Knoten (33 km/h, die Höchstgeschwindigkeit 19 Knoten (35,2 km/h).
Nach dem eingangs erwähnten Auftrag der CGN SA werden im Oktober 2020 die Siemens Energy SRL in Mailand und der Schweizer Hersteller von Akkumulatoren und Energiespeichersystemen Leclanché SA für die Lieferung der Ausrüstung der zwei neuen Hybridschiffe bestimmt. Das Marine Rack System (MRS) von Leclanché, das mit den firmeneigenen hochenergetischen G-NMC-Li-Ionen-Zellenbatterien betrieben wird, ist speziell für die Schiffahrtsindustrie entwickelt worden, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe um 40 % zu senken. Es wird u.a. bei der vollelektrischen dänischen Fähre Ellen eingesetzt (s.o.).
Die Energieversorgung und das Antriebssystem basieren auf dem BlueDrive-Eco- System von Siemens, die zwei 920 kW Dieselmotoren stammen von Wärtsilä und der 2 x 225 kW Antrieb wird mit Linear-Jets von Voith realisiert. Zusätzlich werden Bug- und Heckruder mit Voith Inline Thrusters eingesetzt. Ende des Jahres wird mit der Vorproduktion der ersten Rumpfsektionen gestartet.
Die beiden neuen 61,3 m langen und 11,4 m breiten Naviexpress-Fähren mit einer Kapazität von jeweils 700 Passagieren werden bestehende dieselbetriebene Schiffe ersetzen und für den Passagiertransport zwischen Lausanne in der Schweiz und den französischen Städten Evian-les-Bains sowie Thonon-les-Bains eingesetzt.

Ihre Fertigstellung ist für 2022 und 2023 geplant, der Totalpreis für die zwei Schiffe wird mit 57 Mio. CHF angegeben. Tatsächlich wird die finale Inbetriebnahme des ersten Schiffes aber erst Anfang 2024 abgeschlossen, in den fahrplanmäßigen Betrieb geht die MS Évian-les-Bains offiziell im Dezember. Schon nachdem diese die Werfthalle verlassen hatte, erfolgte im Herbst 2022 die Kiellegung des Schwesternschiffes MS Thonon-les-Bains, das dann ab Januar 2025 in Dienst geht.
Zu den weiteren Aktivitäten der Shiptec zählen die Elektrifizierung des 14,9 m langen und 3,4 m breiten Kursschiffes MS Heimat der Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG), das ab April 2022 wieder auf dem Greifensee unterwegs ist und nun als das erste vollelektrische Kursschiff der Deutschschweiz gilt. Der Antrieb besteht aus einem 40 kW Elektromotor.
Das im Jahr 1933 gebaute und bislang per Dieselmotor angetriebene Schiff mit einer Kapazität von 60 Personen führt im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) das ganze Jahr über täglich bis zu zwölf Fahrten zwischen Maur und Uster auf dem Greifensee durch. Darüber hinaus wird das Schiff für Extrafahrten wie Hochzeits-Apéros und Transfers eingesetzt. Mit einer Ladung der verbauten 99 kWh Lithium-Ionen-Batterien über Nacht kann der Kursbetrieb während des ganzen Tages gefahren werden, und zusätzlich steht am Abend noch genug Reserve-Leistung für eine Extrafahrt zur Verfügung.

Mitte Mai 2022 wird die Neumotorisierung der MS Berna mit einem seriellen hybriden Energie- und Antriebssystem abgeschlossen. Die Stromerzeugung erfolgt durch zwei Generatoren mit 135 kW bzw. 180 kW, die die zwei elektrischen 180 kW Motoren sowie die 85 kWh Lithium-Ionen-Batterien und die restlichen Verbraucher an Bord mit Energie versorgen. Das 48,24 m lange und 9 m breite Schiff der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft AG, das ursprünglich 1964 in Betrieb genommen wurde, kann 600 Personen aufnehmen.
Ab dem Winter 2023 wird zudem das Motorschiff eMS Rütli der SGV elektrifiziert, das ab Mai 2024 wieder täglich auf dem Vierwaldstättersee unterwegs ist. Das ,e’ im Namen des Schiffs steht für natürlich die Elektrifizierung. Das älteste und kleinste Motorschiff der SGV-Flotte war im Jahre 1929 in Dienst gegangen und bekommt nun einen 180 kW Elektromotor und 260 kWh Batterien als Energiespeicher, wofür 1,2 Mio. CHFr investiert werden. Das Schiff, das vorwiegend auf der kurzen Spazierfahrt-Route von Luzern nach Meggenhorn unterwegs ist, ist 22,6 m lang, 5 m breit und hat eine Kapazität von 120 Personen.
Darüber hinaus plant die SGV gemeinsam mit der Shiptec das o.e. Motorschiff Saphir ab Sommer 2026 mit Wasserstoff zu betreiben. Im Rahmen des Projekts ,Zero-Emission-Saphir’ soll bereits Anfang 2025 eine Wasserstoffproduktionsanlage der H2Uri AG beim Wasserkraftwerk Bürglen in Betrieb gehen.
Ebenfalls auf dem Genfer See fährt ab Oktober 2019 das
Solarboot Greta, bei dem es sich um einen für 25 Passagiere
zugelassenen Aquabus 1050 der schon mehrfach erwähnten Schweizer Schiffbaufirma Grove
Boats SA bzw. deren Vorgänger MW-Line handelt,
der ein 9 m2 großes Solardach besitzt, das einen 8 kW Elektromotor
speist. Grove Boats ist möglicherweise der älteste kommerzielle Solarboothersteller
der Welt, der auch an vielen bahnbrechenden Projekten beteiligt war,
darunter der Sun21 (2007)
- die erste Atlantiküberquerung ausschließlich mit Solarenergie - sowie
der PlanetSolar Tûranor (ab 2010),
das erste Boot, das die Welt umrundet hat.

Im Februar 2022 ist zu erfahren, daß auch die MS
Jungfrau, das Flaggschiff der Touristikflotte der BLS
Schiffahrt AG (BLSSF), das zwischen Interlaken-Ost und Brienz
fährt, zu einem Hybrid-Schiff umgebaut worden sei. Als eidgenössisch
konzessioniertes Transportunternehmen mit Sitz in Thun erbringt die
BLSSF auf Basis einer Konzession des Bundesamts für Verkehr (BAV) Fahrleistungen
auf dem Thunersee und dem Brienzersee.
Die für 700 Personen zugelassene MS Jungfrau war 1954 gebaut worden und wurde nun komplett modernisiert und mit einem hybriden Elektro- und Dieselantrieb ausgestattet. Der Antrieb umfaßt ein 168 kWh Lithium-Ionen-Batteriesystem des Schweizer Herstellers Leclanché, das aus zwei Einheiten von je zwölf Modulen besteht und einen 30-minütigen reinen Elektrobetrieb ermöglicht. Ist das Schiff im Hybrid-Modus unterwegs, hält die Batterie bis zu 10,5 Stunden. Die Ladezeit am Hafen wird mit weniger als 1,5 Stunden angegeben.
Ab August 2025 ist die EMS Uetliberg als
erstes vollelektrisches Großfahrgastschiff für bis zu 300 Passagiere
im täglichen Kursbetrieb auf der kleinen Seerundfahrt auf dem Zürichsee
unterwegs, die zu diesem Zeitpunkt als das größte elektrische Schiff
der Schweiz gilt. Im Laufe von zehn Monaten war das im Jahr 1999 gebaute
Motorschiff der Zürichsee Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)
bei dem Stralsunder Schiffsbaubetrieb Ampereship komplett
ausgehöhlt und im Innern neu aufgebaut worden. Es ist der erste derartige
Auftrag für den Betrieb.

Indem der Dieselantrieb des 42,4 m langen Fahrgastschiffes entfernt und zwei Elektromotoren nebst einem 20 Tonnen schweren 3,6 MWh Batteriepack eingebaut werden, die als die größte gilt, die bislang in einem Schiff in Europa installiert worden ist, wird aus der MS Uetliberg die EMS Uetliberg. Die Batterie, die über Nacht in der ZSG-eigenen Werft in Zürich-Wollishofen mit Ökostrom geladen wird, liefert genug Strom für sieben kleine Seerundfahrten pro Tag.
Die EMS Uetliberg ist aber nicht das einzige Elektroschiff. Bereits im Jahr 2021 waren für den Einsatz auf dem Fluß Limmat die baugleichen, 22,5 m langen und 3,80 m breiten Schwesterschiffe MS Albis und MS Pfannenstiel mit 60 Plätzen pro Schiff bestellt worden, die dann ab Juni 2022 ausgeliefert werden und im April 2023 in den Einsatz gehen. Sie werden jeweils von zwei 55 kW Elektromotoren mit Ruderpropellern angetrieben und verfügen über eine Batteriekapazität von 348 kW. Die Schiffe fahren im Regelbetrieb 12 km/h, können aber auch bis zu 16 km/h erreichen.
Die drei Neubauten ersetzen drei dieselbetriebene Schiffe, die seit rund 30 Jahren auf der Limmat unterwegs sind. Insgesamt investiert die ZSG bis 2027 einen Betrag von 21,5 Mio. SFr in die Elektrifizierung, finanziert wird der Betrag über den Zürcher Verkehrsverbund, deren Partner die ZSG ist.
Auch in Großbritannien, das England, Schottland und Wales umfaßt, gibt es Interesse an neuen Antriebsformen für Fähren und Schiffe. So startet Anfang Juli 2018 das EU-geförderte Forschungsprojekt HySeas III, dessen Ziel der Bau der „weltweit ersten hochseefähigen Fähre mit Brennstoffzellen-Antrieb“ ist, wobei der erforderliche Wasserstoff aus erneuerbaren Energien stammen soll. Mit dem völlig neuen Schiffstyp, der das derzeit eingesetzte dieselbetriebene Schiff ersetzen soll, wird ab 2021 der Fährbetrieb zwischen den schottischen Inseln Orkney und Shapinsay realisiert.

(Grafik)
Koordiniert von der schottischen University of St Andrews und unter Leitung der in Port Glasgow ansässigen Werft Ferguson Marine Ltd. wird die Fähre mit einer Länge von 35 m (später: etwa 40 m) und einer Breite von 10 m auf eine Kapazität von 120 Passagieren, 16 Pkw oder zwei Lastwagen ausgelegt. Die Wahl von Wasserstoff-Brennstoffzellen für den elektrischen Antrieb kommt nicht von ungefähr, denn bereits seit rund fünf Jahren erzielen die Orkneyinseln vor der Nordküste Schottlands durch Wind-, Wellen- und Gezeitenkraftwerke einen Überschuß an erneuerbaren Energien.
Aufgrund begrenzter Netzkapazitäten zum Festland entschloß man sich, die Überschüsse direkt vor Ort in Wasserstoff umzuwandeln. Parallel wurde mit der Errichtung einer Wasserstoff-Infrastruktur begonnen, so daß die zukünftige Fähre mit einem mobilen Trailer betankt werden kann. Die an dem EU-Projekt beteiligten Wissenschaftler des Instituts für Vernetzte Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) untersuchen derweil, ob das neue Schiffskonzept auch wirtschaftliche und ökologische Vorteile bringt. Wie umweltfreundlich die Wasserstoff-Fähre im Vergleich zur Konkurrenz ist, soll zudem eine ökologische Analyse zeigen.
Die wissenschaftlichen Grundlagen für HySeas III wurden bereits in den Vorgänger-Projekten HySeas I und II gelegt, die die technischen, ökonomischen und sozioökonomischen Aspekte von wasserstoffbetriebenen Fähren in sehr allgemeiner Form untersucht hatten, bevor nun in dem auf 42 Monate angelegten dritten Teil die eigentliche Umsetzung des Fährkonzepts erfolgt. Projektpartner sind neben den o.g. das Orkney Island Council (beide Schottland), der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power Systems (Dänemark), Kongsberg Maritime (Norwegen), Interferry (Belgien) und der Power-to-Gas-Spezialist McPhy (Frankreich).
Eigentlich sollte die wasserstoffbetriebene Elektrofähre ab 2019 gebaut werden, mit Stapellauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2020, doch ab 2021 wird Ferguson Marine nicht mehr als Partner gelistet. Stattdessen werden nun die Arcsilea Marine Consulting sowie die Caledonian Maritime Assets Ltd. (CMAL) aufgeführt, die für das Schiffsdesign und die Entwicklung verantwortlich sind und im Oktober gemeinsam mit der Beratungsfirma AqualisBraemar LOC (später: ABL Group ASA) einen ersten Entwurf für das Schiff präsentieren. Die endgültigen Entwürfe sollen im März 2022 vorgelegt werden.
Tatsächlich verschiebt sich die Indienststellung der Fähre immer weiter, und ein echter Prototyp-Einsatz fand bis Mitte 2025 noch immer nicht statt.
Im September 2020 meldet die Schweizer ABB, daß sie von der chinesischen Guangzhou Shipyard International Ltd. mit der Lieferung einer umfassenden Palette integrierter Lösungen für zwei neue Schiffe der britischen Reederei P&O Ferries beauftragt wurde, die 20 Fähren auf acht Routen von Schottland nach Nordirland und von England zum Festland betreibt und jedes Jahr 8,4 Millionen Passagiere, 1,6 Millionen Autos und 2,2 Millionen Frachteinheiten befördert.

(Grafik)
Die neue hybride Antriebslösung, die ihre elektrische Energie aus 8,8 MWh Batterien und Dieselgeneratoren bezieht, soll den Kraftstoffverbrauch auf der P&O-Route zwischen Dover und Calais um 40 % senken.
Die Guangzhou Shipyard setzt beim Bau auf eine doppelseitige Ausführung, so daß die Schiffe an jedem Ende mit zwei Azipod-Einheiten und einer Brücke ausgestattet sind und somit im Hafen kein Wendemanöver erforderlich ist.
Die 230 m langen Doppelendfähren, die entwickelt wurden, um die älteren Einheiten Pride of Canterbury und Pride of Kent zu ersetzen, werden jeweils mit vier Azipod-Antriebseinheiten mit einer Leistung von je 7,5 MW ausgestattet. Die Batterien liefern die gesamte Energie für das Manövrieren und den Aufenthalt im Hafen. Die erste Einheit, die P&O Pioneer, nimmt ihren Dienst auf der ca. 34 km langen Überfahrt von Dover nach Calais im Juni 2023 auf, während die zweite Einheit, die P&O Liberté, im März 2024 in Betrieb genommen wird.
Im Dezember 2024 absolviert die Saint Malo des britischen Fährbetriebs Brittany Ferries erfolgreich ihre Jungfernfahrt. Die in der chinesischen Werft CSC Jinling gebaute Hybrid-Fähre besitzt die mit 12 MWh größte Batterie, die bislang auf einem Schiff installiert wurde. Insgesamt nimmt die Batterie des in Andorra ansässigen Herstellers AYK Energy SLU vier Batterieräume an Bord der Fähre ein.

Das Schiff ist so konzipiert, daß es beim Ein- und Auslaufen in den Hafen ausschließlich mit Batteriestrom betrieben wird, doch Testfahrten zeigen, daß die Fähre auch bei einem möglichen Motorausfall auf Batteriebetrieb umschalten kann und dabei eine Geschwindigkeit von 14 Knoten beibehält. Der Betrieb der Saint Malo ist damit auf Flüssigerdgas (LNG), Batteriestrom oder eine Kombination aus beidem ausgelegt. Entsprechend handelt es sich um eine Hybrid-LNG-Elektrofähre.
Der Fährbetrieb, der zwischen den Häfen von Portsmouth (Großbritannien) und St. Malo (Frankreich) verläuft, soll 2025 aufgenommen werden. Portsmouth ist gegenwärtig der einzige Fährhafen in Großbritannien, der elektrischen Land-zu-Schiff-Strom anbietet. Diese Dienstleistung wurde im Rahmen des Projekts Sea Change realisiert, das im Februar 2023 angekündigt, von der britischen Regierung finanziert und in Partnerschaft mit Innovate UK durchgeführt worden war.
Brittany Ferries hat derweil ein weiteres Hybrid-Schiff in Auftrag gegeben.
Anfang Dezember 2025 sticht die erste vollelektrische Passagierfähre Großbritanniens in See. Die Orbit Clipper absolviert ihre Passagierfahrten über die Themse und läutet damit eine neue Ära des nachhaltigen Verkehrs in London ein. Die Fähre verkehrt zwischen Rotherhithe auf der Südseite des Flusses und Canary Wharf auf der Nordseite.

Die Orbit Clipper wurde mit finanzieller Unterstützung des Verkehrsministeriums und von Innovate UK entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Wight Shipyard Co., dem Ingenieurbüro Beckett Rankine und dem Spezialisten für elektrische Infrastruktur, Aqua superPower, gebaut. Sie ist im Besitz von Uber Boat by Thames Clippers und wird von diesem auch betrieben. Das Unternehmen verfügt bereits über drei Hybrid-Hochgeschwindigkeitsfähren: Earth Clipper, Celestial Clipper und Mars Clipper, die seit 2023 bzw. 2024 im Einsatz sind.
Die neue 25,20 m lange und 10,10 m breite Orbit Clipper wird nun schrittweise in Betrieb genommen, wobei der vollständige Betrieb und die Exklusivität der Strecke für das Frühjahr 2026 geplant sind. Sobald es voll einsatzfähig ist, wird das 150-Personen-Schiff, das auch Platz für 100 Fahrräder bietet, den Fluß werktags alle 10 Minuten und am Wochenende alle 15 Minuten überqueren. Angetrieben wird die Fähre von 150 kW Elektromotoren und Hydromaster-360°-Azimut-Antrieben, als Akku dient eine Batterie von EST Floattech mit 960 kWh. Die Fähre erreicht eine Geschwindigkeit von 10 Knoten.
In Thailand ersetzt die Verkehrsbehörde Bangkok Metropolitan Authority (BMA) den 205 PS starken Dieselmotor in einem 14,5 m langen Flußschiff durch zwei 10 kW starke Torqeedo-Motoren. Im November 2018 wird das erste vollelektrische Boot für den Pendelverkehr durch den thailändischen Premierminister Prayut Chan-o-cha persönlich in Betrieb genommen, indem er die Fahrt mit dem Elektroschiff als letzte Etappe einer symbolischen emissionsfreien Fahrt nutzt, die auch Strecken zu Fuß, mit dem Skytrain und der U-Bahn umfaßt.
Das Schiff mit Glaserfaserrumpf bietet Platz für 40 Passagiere und die Energieversorgung der Motoren übernehmen sechs Lithium-Batterie-Einheiten, deren Nachfüllen mit zwei Schnelladern erfolgt.
Im Februar 2019 kündigt dann das private Energieversorgungsunternehmen Energy Absolute PCL (EA) Pläne für den Bau und Betrieb einer Flotte elektrischer Pendlerfähren an, die mit den staatlich betriebenen Teilen des Flußverkehrssystems verbunden werden sollen. Die EA wird manchmal als der ,Tesla Südostasiens’ bezeichnet, weil ihr Gründer, der Milliardär Somphote Ahunai, ein integriertes Netzwerk aufbaut, das eine Elektrofahrzeugfabrik, Solar- und Windparks, Anlagen zur Herstellung von Batterien, die neuen Elektrofähren sowie die Ladegeräte umfaßt, die sie alle miteinander verbinden.
Die 24 m langen Aluminiumkatamarane, die jeweils 131 stehende und 104 sitzende Passagiere aufnehmen können, werden durch zwei Elektromotoren von Danfoss Editron mit einer Leistung von jeweils bis zu 192 kW sowie Li-Ionen-Akkus mit 800 kWh aus der EA-Batteriefabrik angetrieben und über ein Netz von Schnelladesäulen versorgt, mit denen sie in 15 - 20 Minuten aufgeladen werden können.
Die Reichweite beträgt 80 - 100 km und die Fähren können mit voller Ladung 2 - 4 Stunden lang mit einer Dienstgeschwindigkeit von 11 Knoten (20,4 km/h) bzw. der Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten (27,8 km/h) auf dem Wasser fahren. Die EA will nun 24 dieser Boote sowie 20 weitere E-Schiffe bauen, wofür umgerechnet 33 Mio. $ investiert werden.
Im März 2020 genehmigt das BMA den Kauf von sieben elektrischen Kanalbooten für 30 Passagiere, die in der Region Khlongs of Thonburi eingeführt werden sollen - wo ihre Nutzung in den ersten drei Monaten kostenlos ist.

Smart Ferry
Sowohl das BMA als auch Energy Absolute streben den Sommer 2020 als Starttermin für ihre Dienste an, was sich jedoch als unrealistisch erweist. Immerhin können beide im August Videos über ihre Planungen und bisherigen Umsetzungen veröffentlichen. So werden der Bau, die Wasserung und Fahrtests des ersten vollständig fertiggestellten EA-Katamarans gezeigt, der ein PV-Dach besitzt und den Namen MINE Smart Ferry (später: Thai Smile Boat) trägt, wobei MINE für ,Mission No Emission’ steht.
Die Firma erklärt nun, daß die 24 Fähren und 20 elektrischen Flußkreuzfahrtschiffe schon bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden sollen, weitere zehn Schiffe sind für 2021 geplant. Betrieben werden die EA-Katamarane, von denen zwei Exemplare bereits Testfahrten durchführen, von der Chao Praya Express Boat Co., die mit 70 Booten als das größte Unternehmen gilt, das Reisedienstleistungen entlang des Flusses Chao Phraya bietet.
Eine Besonderheit ist, daß die Fähre 26 Gleichstromstecker besitzt, was für die erforderliche Ladeleistung von 2,4 - 3,2 MW für die Schnelladung einer 800 kWh Batterie in 15 - 20 Minuten eigentlich zu viel ist. Auf dem Steg sind auch die entsprechenden Ladegeräte zu sehen, was vermutlich auf die firmeneigene Produktpalette zurückzuführen ist.
Außerdem stellt das Marineministerium im August 2020 eine neue E-Fähre für 100 Passagiere vor, die in Zusammenarbeit mit der Kasetsart University in Bangkok entwickelt wurde. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 22 km/h und wird auf der Saen-Saeb-Pendlerstrecke eingesetzt. Das Ministerium plant, bis 2021 etwa 30 Fähren zum Einsatz zu bringen, bevor drei bis vier Jahre später auf 200 Fähren im ganzen Land expandiert wird.

Next e-Ferry
Hinzu kommt Banpu, ein weiterer großer Akteur im Bereich der neuen Energie in Thailand, der zu dieser Zeit mit der Erprobung seiner Banpu Next e-Ferry (o. Banpu E-Ferry) beginnt, die für Touristen in der Region Phuket konzipiert ist, wo Dutzende von Fährgesellschaften in- und ausländische Besucher auf eine der 33 Inseln bringen.
Im Dezember 2020 werden in Bangkok sieben weitere umgerüstete Elektroboote in Betrieb genommen, gefolgt von zwölf zusätzlichen vollelektrischen Pendlerfähren im Juli 2021. Und im Jahr 2023 präsentiert die EA die zweite, etwas kleinere Serie der elektrischen Katamaran-Fähren, die 19 m lang sind und 150 Passagiere transportieren können.
Aus Island, wo etwa 80 % der Energie aus Wasserkraft und Erdwärme stammen, wird im Februar 2019 berichtet, daß Schweizer ABB die integrierte Stromversorgungs- und Stromspeicherlösung für eine neue Fähre der isländischen Straßen- und Küstenverwaltung Vegagerðin liefern wird, die jährlich 3.600 Fahrten in den rauhen Gewässern zwischen Landeyjahöfn auf dem Festland und der Insel Westman durchführen soll, wo die Wellenhöhe bis zu 3,5 m betragen kann, und dabei jeweils 13 km in etwa 45 Minuten zurücklegen wird.

(Grafik)
Die 70 m lange neue Fähre mit einer Kapazität von 550 Passagieren und 75 Autos, die die 1992 gebaute MF Herjólfur ersetzen wird, soll noch im Laufe des Jahres von der Werft Crist S.A. geliefert werden. Das Konzeptdesign der Fähre wurde von Polarkonsult erstellt.
Das Schiff wird mit einem 3 MWh Batteriepaket ausgestattet und ist so konzipiert, daß es die meiste Zeit über vollelektrisch betrieben werden kann, wobei es in beiden Häfen an Land aufgeladen wird. Bei besonders schwierigen Wetterbedingungen, wenn der Batterieverbrauch die verfügbare Energie übersteigt, kann die Fähre auch ihr dieselelektrisches Aggregat nutzen.
Entscheidend für die unterstützende Infrastruktur an Land ist der von ABB gelieferte Landstromanschluß zum Aufladen der Batterie mit einer Leistung von 2,5 MW, während die Fähre im Dock liegt. Im Durchschnitt dauert das Aufladen etwa 30 Minuten.
In China wird Mitte November 2019 die erste Elektrofähre vom Stapel gelassen, die nun auf dem Fluß Jangtse in Wuhan Passagiere befördert und Sightseeing-Touren durchführt.

Die vollständig batteriebetriebene Junlyu wurde vom Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion gebaut, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Es gibt keine Angaben zur Größe oder Leistung des Motors oder des Energiespeichers, aber die Fähre ist 53 m lang, 13 m breit, kann bis zu 300 Passagiere befördern und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 19 km/h fahren. Bei einer Geschwindigkeit von weniger als 13 km/h (7 Knoten) kann sie acht Stunden lang in Betrieb bleiben.
Abgesehen von einigen kleinen Elektrobooten, die von Besuchern in Parks genutzt werden, ist das einzige andere chinesische Elektroschiff, das bekannt ist, ein Frachtschiff aus dem Jahr 2017, dessen Aufgabe ironischerweise darin besteht, Kohle zu einem Kraftwerk zu transportieren. Es wird uns noch in einer späteren Jahresübersicht begegnen.
Ebenfalls im November 2019 wird in Kanada die vollelektrische Doppelendfähre Amherst Islander II zu Wasser gelassen, die im Fährdienst zwischen dem Festland bei Millhaven und Amherst Island eingesetzt werden und Platz für 300 Personen und 42 Fahrzeuge bieten wird. Das Schiff ist Teil eines Projekts zur Modernisierung der Fährverbindungen in der Region Ontario.

Amherst Islander II
Die 71,7 m lange und 19,8 m breite Fähre, die von Damen Shipyards in Galati, Rumänien, gebaut wurde, ist eine der ersten vollelektrischen Autofähren Nordamerikas und nutzt vier Elektromotoren mit jeweils 520 kW und ein 1,9 MWh Lithium-Ionen-Batteriesystem. Zusätzlich stehen für die Stromerzeugung zwei von Dieselmotoren mit jeweils 565 kW Leistung angetriebene Generatoren zur Verfügung.
Eine zweite, größere Fähre von 98 m Länge, die 2021 in Betrieb gehen soll, wird von Kingston nach Wolfe Island verkehren und dabei bis zu 400 Personen und 80 Autos befördern. Auch diese besitzt vier Elektromotoren mit jeweils 520 kW Leistung, aber das Batteriesystem ist mit 4,6 MWh wesentlich stärker. Der Stapellauf der Wolfe Islander IV erfolgt im September 2020. Beide Schiffe haben eine Höchstgeschwindigkeit von 12 Knoten (andere Quellen: 13,5 Knoten).
Die Provinz Ontario investiert rund 94 Mio. $, und die kanadische Regierung beteiligt sich mit bis zu 31 Mio. $ am Bau der beiden neuen Fähren. Der Vertrag mit Damen umfaßt auch ein automatisches Anlege- und Ladesystem, bei dem die Schiffe beim Anlegen automatisch an das Landstromnetz angeschlossen werden. Der Betreiber der Fähren ist das Ministry of Transportation Ontario.

der Fähren
Die British Columbia Ferry Services Inc. (BC Ferries), die mit rund 40 Schiffen das Fährsystem in der Provinz British Columbia in Westkanada betreibt, nimmt Mitte 2020 zwei Elektro-Hybridfähren in Betrieb, die als Island Class bezeichnet werden, weil sie vom Festland zu einem Archipel von kleinen Inseln fahren. Nach Kanada gebracht worden sind die Fähren mit dem (konventionellen) Frachtschiff Sun Rise, das einige Stunden lang teilweise untertaucht, um die kleineren Boote zu Wasser zu lassen und in den Hafen der Stadt Victoria zu befördern.
Die von den Damen Shipyards gebauten Doppelendfähren sind 81 m lang, haben eine Kapazität von 390 Passagieren und 47 Pkw und sind neben ihrem Dieselgenerator mit 2 MWh Batteriepaketen ausgestattet. Die Schnelladung erfolgt im Hafen, und es ist bereits eine dauerhafte Umstellung auf reinen Batteriebetrieb vorgesehen. Die Fähren bilden den Auftakt für eine umfassende Flottenmodernisierung bei BC Ferries, die inzwischen noch vier weitere Einheiten dieser Klasse geordert hat.
Im Januar 2026 folgt die Meldung, daß ABB vier neue Doppelend-Hybridfähren von BC Ferries mit der kompletten Energie-, Antriebs- und Steuerungstechnik ausstatten wird, darunter Batteriespeicher mit einer Kapazität von 70 MWh. Die Auslieferung der Schiffe, die auf der Werft China Merchants Industry Weihai (CMI Weihai) gebaut werden, ist ab 2029 geplant.
In Griechenland wird im Dezember 2019 die erste Elektrofähre des Landes auf der 10 km langen Strecke über den Golf von Korinth zwischen dem Hafen von Aigio auf der Peloponnes und dem Dorf Agios Nikolaos in der Region Dorida auf dem Festland in Betrieb genommen. Bei der Fähre handelt es sich um den Umbau eines vorhandenen Dieselschiffs.
Mit einer Küstenlänge von fast 14.000 km verfügt Griechenland über Hunderte, wenn nicht Tausende von großen und kleinen, schnellen und weniger schnellen Fähren für Besucher und Einheimische, die von Insel zu Insel und von Festlandshafen zu Festlandshafen fahren.
Das Land ist eine der großen maritimen Nationen der Welt, hat sich aber nur langsam auf Elektrofähren eingelassen, was zum großen Teil daran liegt, daß viele der Routen lange Nachtfahrten zu den Inseln beinhalten, die die bisherigen rein elektrischen Möglichkeiten überfordern. Zudem ist der Betrieb großer Elektroboote nach griechischem Recht nicht erlaubt, aber es wird erwartet, daß die entsprechenden Gesetzesänderungen im nächsten Monat verabschiedet werden.
Das Agios-Nikolaos-Pilotprojekt - eine Kooperation zwischen den Gemeinden Aigio und Agios Nikolaos Doridos sowie mehreren Universitäten und der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV GL - ist Teil eines größeren Vorhabens, zu dem auch ein Offshore-Kraftwerk gehört, das den Strom für die Fähre liefert. Die Anlage umfaßt ein hybrides Stromerzeugungssystem, das Solar-, Wellen- und Windtechnologien kombiniert. Der überschüssige Strom wird sozial schwachen Bewohnern der beiden Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das System wird in dem neuen, aber geschlossenen Hafen von Aigio auf dem Nordpeloponnes installiert, der seit seinem Bau nie in Betrieb war und daher sowohl funktionell als auch konstruktiv aufgerüstet wird. Die Kosten des gesamten Projekts einschließlich Kraftwerk werden auf 4 - 5 Mio. € veranschlagt, von denen die EU 50 % bereitstellt. Mittelfristiges Ziel des Pilotprogramms ist es, es auf alle kurzen Fährverbindungen des Landes auszuweiten. Bislang ließen sich aber keine weiterführenden Informationen finden.
Im Juli 2022 wird über ein Elektrofährenprojekt namens Transport
Electrification on Sea and Land in Antiparos (TESLA) berichtet,
das von der Fährgenossenschaft Paros-Antiparos und
der Gemeinde Antiparos gefördert, von der Europäischen
Inselfazilität NESOI unterstützt und vom Centre for Research and Technology
Hellas (CERTH) verwaltet wird.
Das Projekt hat das Ziel, eine oder mehr der vier Fähren, die die Strecke zwischen den Inseln Paros und Antiparos befahren, elektrisch zu betreiben, indem das herkömmliche Antriebssystem durch ein Batterie- und Generatorensystem ersetzt wird. Die beiden Inseln sind nicht weit voneinander entfernt, und die Fähren brauchen nur sieben Minuten und verkehren während der Touristensaison häufig.
Das Hauptziel von TESLA ist die Elektrifizierung des Land- und Seeverkehrs auf Antiparos mit Hilfe erneuerbarer Energien. Darüber hinaus ist geplant, Ladestationen für Elektrofahrzeuge einzurichten und die kommunale Flotte von Antiparos teilweise zu elektrifizieren. Um den Bedarf an Fähren und Elektrofahrzeugen zu decken, sind bereits PV-Paneele errichtet worden. Die Fähre selbst soll 2026 fertiggestellt werden, nähere technische Details sind bislang nicht bekanntgegeben worden.

(Grafik)
Ebenfalls im Juli 2022 kündigt die griechische Reederei Saronic Ferries eine Partnerschaft mit der Firma C-Job Naval Architects in den Niederlanden an, um das Design der ersten vollelektrischen RoPax-Fähre des Landes zu entwickeln. Die Saronic Ferries hatte bereits im Vormonat auf der Messe Posidonia 2022 eine Absichtserklärung mit der DNV GL unterzeichnet, deren Ziel die Entwicklung eines vollelektrischen Konzepts für den Einsatz auf Kurzstrecken-Passagierschiffen in der Region der Argosaronikos-Bucht ist. Die Reederei plant, bis zum Jahr 2040 eine vollständig elektrisch betriebene Fährflotte zu haben.
Dem aktuellen Entwurf zufolge soll die Fähre 85 m lang und 15,8 m breit werden. Sie kann bis zu 800 Personen und eine Kombination aus sechs Lastwagen und 55 Autos aufnehmen (andere Quellen: 90 Autos). Das Schiff, das auch bei rauhem Wetter fahren kann, was auf den Inseln in der Ägäis manchmal der Fall ist, soll im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden und zwischen Piräus und den Inseln Ägina und Agistri verkehren.
Das vollelektrische Antriebssystem wird eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 14,5 Knoten erlauben. Über die Batterien ist noch nichts bekannt, doch das Schiff soll im Hafen von Piräus aufgetankt werden, was allerdings von der Ladeinfrastruktur abhängt, die dort ebenfalls bis 2026 errichtet werden muß.
Wie die Fachblogs im Januar 2020 berichten, wird auch Malta bald zwei umweltfreundliche Fähren haben, die von der Hauptinsel Malta zur Insel Comino fahren.

(Grafik)
Die Hybridschiffe wurden von maltesischen Marineingenieuren nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert und sind größer und schneller als die derzeitige Flotte. Der Comino Ferries Coop zufolge, die den Dienst betreiben wird, sollen die Fähren in der Nähe von Comino, Marfa und Cirkewwa emissions- und lärmfrei im reinen Elektrobetrieb fahren. Die beiden neuen Fähren werden die derzeit von der Genossenschaft eingesetzten zehn Schiffe ersetzen, da sie größer und besser ausgestattet sind, um die Strecke professioneller zu bedienen.
Aufgrund verschiedener Bedenken, die bei der Malta Public Transport eingehen, wird der vertraglich vereinbarte Dienst mit einer Laufzeit von 15 Jahren zwischen der Behörde und Comino Ferries allerdings verschoben. Die Behörde hatte eigentlich beschlossen, 5 Mio. in neue Fähren und Einrichtungen zu investieren - doch bislang scheint das Projekt noch nicht weitergekommen zu sein.
Im September folgt die Meldung, daß die britische Werft Wight
Shipyard Co. (WSC) im Zuge ihres bisher größten Exportauftrags
für das maltesische Tourismus- und Kreuzfahrtunternehmen Captain
Morgan Holdings Ltd. innerhalb eines Jahres gleichzeitig vier
große Fähren hergestellt habe, die von One2Three Naval Architects in
Australien entworfen worden waren. Der Auftrag umfaßt zwei 20 m und
zwei 33 m lange Fähren, die leichter und effizienter konzipiert sind
als alle Schiffe, die die Werft bisher gebaut hat.

Captain Morgan Holdings
Die beiden kleineren Katamarane, die jeweils 197 Passagiere befördern können, werden bestehende Schiffe ersetzen, welche historische Hafenrundfahrten um die beiden Naturhäfen rund um die Hauptstadt Valletta durchführen. Sie sind als langsamere Hafen-Wasserbusse für häufige Stopps konzipiert, werden von zwei 270 kW Motoren angetrieben und erreichen Geschwindigkeiten von 8 - 10 Knoten, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten.
Die beiden 33 m langen Mittelgeschwindigkeitsschiffe, die ebenfalls alte Modelle ersetzen, werden einen neuen Hop-on-Hop-off-Service für Pendler und Touristen entlang der Ostküste Maltas bis zur Insel Gozo anbieten. Sie sind für 298 Passagiere ausgelegt, mit Schiffsdieselmotoren mit einer Leistung von 2 x 749 kW ausgestattet, haben eine Fahrtgeschwindigkeit unter 20 Knoten, können aber eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten erreichen.
Auch in Indien gibt es eine Solar-Fähre, die international bekannt wird, als im Juli 2020 die Abstimmung für den erstmals vergebenen Gustave Trouvé Awards for Excellence in Electric Boats and Boating (auch: Gussies-Preis) abgeschlossen wird, in dem es drei Kategorien gibt: Elektroboote unter 8 m, Elektroboote über 8 m sowie Elektroboote für zahlende Passagiere.

Die bereits 2017 in Südindien in Betrieb genommene sonnenbetriebene Pendlerfähre Aditya von Navalt Boats, die in der dritten Kategorie gewinnt, überquert einen Fluß auf einer Strecke von 2,5 km und unternimmt jeden Tag 22 Fahrten mit 75 Personen an Bord, wobei 80 % ihres Stromverbrauchs aus der Solarenergie stammen. Besonders betont wird, daß die Kosten für das Aufladen der Batterien nur 2,60 $ betragen. Mit einer Einsatzdauer von bis zu zwölf Stunden pro Tag und durchschnittlich fast 600.000 Passagieren pro Jahr hat sich die Aditya als sehr erfolgreich erwiesen.
Das 21 m lange und 7 m breite Schiff besitzt zwei Unterwasser-Pod-Motoren mit 20 kW, 80 kWh Lithium-FePO4-Batterien sowie 2,7 kW PV-Module auf einer Fläche von 140 m2. Die Dienstgeschwindigkeit beträgt 5 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit 7,5 Knoten.
Die Konzeption sowie das Antriebs- und Energiesystem des Katamarans stammen von der o.e. Firma Alternatives Energies aus Frankreich, gebaut wurde er bei der Navalt Ltd. (o. Navalt Solar & Electric Boats Pvt. Ltd.) und sein Betreiber ist das Kerala State Water Transport Department (KSWTD).

Die 2013 gegründete Navalt mit Hauptsitz in Kochi gilt als der erfahrenste Hersteller von Solarschiffen in Indien. Die Firma hatte im Vorfeld bereits 2009 ihr erstes solarbetriebenes Boot gebaut, den Sunrider, und 2012 ein Benzinboot zu einem solarbetriebenen Fischereifahrzeug umgerüstet. 2015 wird mit dem CIFT Sun Boat das erste kompakte Solar-Fischerboot von Navalt konstruiert, gefolgt 2017 von der aktuellen Gewinnerin Aditya.
Im Jahr 2019 wird die Navalt mit dem Preis für effiziente Lösungen der Stiftung Solar Impulse ausgezeichnet und 2022 folgt die Markteinführung des „weltweit ersten solarbetriebenen Fischereibootes“ namens SRAV, das auf offener See fährt. Im Dezember 2023 wird parallel zu dem solarbetriebenen Schnellboot Barracuda auch das bislang größte Solar-Elektroschiff Indiens auf den Markt gebracht, die Indra, die auf ihren zwei Decks 100 Passagiere aufnehmen kann.
Der 27 m lange und 7 m breite Katamaran ist mit 125 m2 Solarpaneelen mit einer Leistung von 25 kW bedeckt, die mit Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 80 kWh verbunden sind und zwei 20 kW Elektromotoren versorgen, von denen sich einer in jedem Rumpf befindet und die eine Geschwindigkeit von bis zu 7 Knoten ermöglichen.
In der Entwurfsphase befinden sich zudem ein Elektroschlepper, ein Elektromassengutfrachter und ein Elektrotanker - neben extrem vielen Konzeptentwürfen, die man sich auf der Firmenhomepage ansehen kann.
Im Juni 2020 geht der schwedische Batteriehersteller Echandia eine Partnerschaft mit Siemens ein, um elektrische Antriebssysteme für 23 Elektrofähren zu entwickeln, die von der Cochin Shipyard Ltd. gebaut werden sollen, um die Stadt Kochi und ihre zehn Inseln zu bedienen.
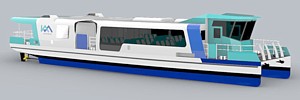
(Grafik)
Das Einsatzgebiet erstreckt sich über eine Strecke von 76 km mit Haltestellen an 38 verschiedenen Terminals und zwei Werften. Echandia wurde aufgrund des Sicherheitsprofils, der Ladekapazität und der erwarteten Lebensdauer der firmeneigenen LTO-Batterien ausgewählt.
Hinter dem Projekt steht die Kochi Metro Rail Ltd. (KMRL), deren Ambition es ist, das erste U-Bahn-System des Landes zu werden, das Schienen-, Straßen- und Wasserverkehrseinrichtungen miteinander verbindet, um die 100.000 Einwohner und Touristen von Kochi energieeffizient und zuverlässig zu transportieren. Der erste vom KSWTD betriebene (konventionelle) Bootsdienst von Vyttila nach Kakkanad war bereits im November 2013 eingeführt worden.
Die aktuelle Bestellung ist die erste Phase eines größeren, von der Regierung von Kerala im Februar 2017 angekündigten Plans, der eine Wasser-Metro aus 78 emissionsfreien Schiffen auf 16 Routen umfassen und die „größte Flotte von Elektrofähren auf der Welt“ bilden wird. Die erste der 23 Elektrofähren liefert die Cochin Shipyard im Januar 2022 aus.

Kochi Water Metro
Die 24 m langen Boote befördern jeweils bis zu 100 Passagiere, wobei die Flotte 16 Stunden pro Tag nach einem engen Zeitplan verkehren soll. Um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten, werden die Fähren, die bis zu einer Stunde im rein elektrischen Betrieb laufen, zwölfmal am Tag jeweils 15 Minuten lang wieder aufgeladen. Zudem will die Kochi Metro Rail eine Infrastruktur für ihre Wasserflotte aufbauen, wie z.B. Andockstationen, die mit Solarenergie oder anderen alternativen Energiequellen betrieben werden.
Das Kochi Water Metro (KWM) genannte System wird im April 2023 von Premierminister Narendra Modi persönlich eingeweiht und für den Passagiertransport geöffnet.
Im Januar 2025 erweitert die KWM ihre Flotte um zwei Notfallboote, die zur Wartung und Instandhaltung sowie bei möglichen Unfällen, Bränden und Naturkatastrophen eingesetzt werden sollen. Die neuen Boote werden über die gleichen technischen Merkmale verfügen wie das von Ultra Marine Yachts Pvt Ltd. gebaute, 16 m lange Katamaranboot Garuda, das im Dezember 2022 in Dienst gestellt worden war.

Das mit moderner medizinischer Ausrüstung ausgestattete Schnellrettungsboot kann mit einer Geschwindigkeit von 18 Knoten fahren und damit auch als Schiffskrankenwagen eingesetzt werden. Da sich keine technischen Spezifikationen finden lassen, ist aber nicht klar, was für eine Art Antrieb diese Boote haben. In Zukunft ist jedenfalls der Kauf eines vierten Schiffes geplant.
Die KWM betreibt zu diesem Zeitpunkt 17 Elektrohybridboote - und bis Ende September 2025 hat die Wassermetro von Kochi schon über 5 Mio. Fahrgäste befördert.
Bereits im Januar 2024 meldet Echandia zudem einen Auftrag der Marine Electricals (India) Ltd., der die Lieferung von sechs Hochleistungsbatteriesystemen umfaßt, die in Hybrid-Elektro-Schiffen installiert werden. Die 24 m langen Katamarane werden von der Hoogly Cochin Shipyard Ltd. (HCSL) in Kalkutta gebaut und sind für den Betrieb durch die Inland Waterways Authority of India (IWAI) auf den Binnenwasserstraßen von Varanasi bestimmt. Die Lieferung ist für das zweite und dritte Quartal vorgesehen.
Auch in Südkorea gibt es Bestrebungen, auf Elektrofähren umzusteigen. So berichtet die Presse im Januar 2021, daß Hafenbehörde von Busan die Werft Heamin Heavy Industries mit dem Bau einer 40 m langen vollelektrischen Katamaranfähre beauftragt hat, die bis zu 100 Passagiere zwischen dem Nord- und dem Südhafen von Busan befördern kann. Die einstündige Rundreise soll mehrmals täglich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13 Knoten (24 km/h) durchgeführt werden.

(Grafik)
Für das Projekt liefert ABB eine elektrische Energie- und Antriebslösung mit zwei 1.068 kWh Batteriepaketen, die genug Strom für bis zu vier Hin- und Rückfahrten liefern, bevor sie während der nächtlichen Stopps wieder aufgeladen werden. Bis 2030 sollen weitere 139 vollelektrische Fähren folgen, die die bestehenden konventionellen Schiffe der Hafenbehörde ersetzen sollen.
ABB hat mit dem Schiffbauer, der sich auf leichte, umweltfreundliche Schiffe spezialisiert hat, bereits eine Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit bei weiteren Projekten unterzeichnet.
Einer Aussage des Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering (KRISO) vom Juni 2024 zufolge wird Südkorea seine erste vollelektrische Autofähre im Folgejahr in Betrieb nehmen, nachdem diese im März 2023 am Pier der Sapjin-Fabrik in Mokpo ihren Stapellauf absolviert und im Mai einen einjährigen Testbetrieb aufgenommen hatte. Das Schiff ist das Ergebnis eines der nationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die vom Ministerium für Ozeane und Fischerei gefördert werden.

des KRISO
Die 60 m lange und 13 m breite Fähre, die umgerechnet rund 18,86 Mio. $ gekostet hat, kann 120 Passagiere und 20 Fahrzeuge befördern. Ihre Reichweite beträgt 30 km. Das Forschungsteam will zunächst Inseln in der Nähe des Hafens Mokpo anfahren.
Ein besonderes Merkmal dieser Fähre ist, daß sie mit zwei festen Batterien mit einer Kapazität von jeweils 250 kWh sowie zwei mobilen Batterien mit einer Kapazität von 800 kWh auf Lastwagen ausgestattet ist. Diese mobilen Batterien können einfach ausgetauscht werden, so daß die Fähre zum Aufladen nicht mehr angedockt werden muß. Mit den Batterien, die von der koreanischen Firma SK ON Co. Ltd. geliefert werden, kann das Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 12 Knoten (22,2 km/h) erreichen.
Sobald die neue Fähre in Betrieb genommen ist, soll sie grundlegende Daten zur weiteren Verbesserung der Betriebseffizienz von Elektrofähren liefern. Das KRISO-Team strebt letztlich an, alle bestehenden Autofähren landesweit durch Elektroschiffe zu ersetzen. Unter der Leitung des KRISO sind fünfzehn Institutionen aus dem akademischen Bereich, der Industrie und der Forschung an der Entwicklung von Elektroschiffen beteiligt.
Aus Portugal wird im April 2021 gemeldet, daß die staatliche Fährgesellschaft Transtejo S.A. (o. Transtejo & Soflusa, TTSL) ihre nicht-elektrischen Fähren ausmustern wird, die in Lissabon für die Beförderung über den Fluß Tejo eingesetzt werden. Demnach hat der spanische Schiffbauer Astilleros Gondán einen Vertrag mit ABB über die Lieferung vollelektrischer Antriebe für zehn schnelle, 40 m lange und 12 m breite Passagierfähren abgeschlossen, die jeweils bis zu 544 sitzende Passagiere und 20 Fahrräder befördern können. Alle zehn Schiffe werden nach Vogelarten benannt, die im Mündungsgebiet des Tejo heimisch sind.

Transtejo S.A.
Die neuen Elektrofähren, die zwischen 2022 und 2024 in Betrieb gehen sollen, werden dann auf drei Strecken eingesetzt: von Lissabon jeweils nach Cacilhas, nach Seixal und nach Montijo. Auf den drei Überfahrten werden jährlich insgesamt rund 19 Mio. Fahrgäste befördert.
Den Antrieb aus zwei 550 kW Hauptmaschinen sowie zwei 55 kW Bugstrahlrudern, die für die in stark befahrenen städtischen Gewässern erforderliche zusätzliche seitliche Manövrierfähigkeit sorgen, liefert der Gesamtintegrator ABB einschließlich der zwei Lithium-Batteriebänke von jeweils 930 kWh. Die autonomen Ladeanschlüsse stammen von der norwegischen Firma Zinus AS. Die Fähren werden bei einer Reichweite von bis zu 70 Minuten eine Dienstgeschwindigkeit von 16 Knoten und eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten erreichen.
Der 52,4 Mio. € teure Kauf der zehn Elektrofähren gerät aber schnell in Verruf, als sich herausstellt, daß die Transtejo nur eine Fähre mit Batterie und die neun anderen ohne gekauft hat. Die zwei Jahre später nachbestellten Batterien sind dann aber nicht kompatibel. Außerdem erweist sich, daß die Schiffe nicht für die Aufgaben konstruiert sind, die sie vor Ort zu bewältigen haben - sie sollten eigentlich auf ruhigen Seen fahren, während sich Gezeitenflüsse wie der Tejo als sehr schwierig erweisen.
Die Cegonha Branca - das erste Schiff, das bereits beschädigt ankam - hat seither weitere schwere Schäden erlitten, weil es an einem Tag mit ,schlechtem Wetter’ mit einem Steg in Berührung kam. Zwei weitere Fähren sind aus technischen Gründen nicht in der Lage zu fahren. Ein zusätzliches Problem bildet das Aufladen der Batterien, denn dies geschieht bislang noch immer über dieselbetriebene Generatoren. Es scheint, als sei das ganze Elektrobootprojekt von den Behörden nicht richtig durchdacht worden.
Berichten im Mai 2025 zufolge befinden sich zwischenzeitlich zwar sechs der zehn Fähren in Portugal, aber nur drei von ihnen funktionieren.

Im November 2021 kursiert die Nachricht, daß auch die Stadt Aveiro im nächsten Jahr ihre erste vollelektrische Fähre in das öffentliche Verkehrssystem integrieren wird, die mit dem elektrischen Antriebssystem von Danfoss Editron betrieben wird, während das Batteriesystem von Sterling PlanB Energy Systems (SPBES) geliefert wird. Das neue, 9 Mio. € teure Einrumpfschiff wird die 1960 gebaute dieselbetriebene Fähre Cale de Aveiro ersetzen, die seit 2004 zwischen Forte da Barra und Aveiro verkehrt.
Die von der portugiesischen Werft Navaltagus Reparação e Construção Naval gebaute 37,4 m lange und 9,2 m breite, zweistöckige Fähre kann bis zu 260 Passagiere und 19 Fahrzeuge befördern, was einer Kapazitätssteigerung von 90 % bzw. 30 % im Vergleich zu ihrem bisherigen Pendant entspricht. Trotz der höheren Kapazität und der neuen Energiequelle wird die neue Fähre ihre Überfahrtzeit von 15 Minuten und ihre Geschwindigkeit von 5 Knoten beibehalten können, wobei die Möglichkeit besteht, 9 Knoten zu erreichen.
Die neue Salicórnia, die Anfang Februar 2024 den Betrieb aufnimmt, ist für 260 Passagiere und 19 Pkw zugelassen, ihre Länge beträgt 37,4 m t. Der Antrieb besteht aus zwei Elektromotoren mit jeweils 200 kW Leistung, die von zwei Akkumulatorbänken mit einer Kapazität von jeweils 511 kWh gespeist werden. Mit ihren zwei Propellergondeln erreicht die Fähre eine Geschwindigkeit von 9 Knoten (17 km/h). Eigentümerin des Schiffes ist die Stadt Aveiro, betrieben wird die Fähre von dem zur Transdev Group gehörenden Unternehmen Aveiro Bus.
Im Dezember 2021 meldet die Volaviamare-Gruppe in Italien, die seit 1944 Touristenfähren im Golf von Neapel betreibt, daß sie ihr 160 Passagiere fassendes Schiff Calypso, das Besucher von und zu den Inseln Ischia und Procida befördert, mit einem elektrischen Wasserstrahlantrieb nachrüsten wird.

Hierzu war mit der italienischen Firma Sealence, dem Hersteller der DeepSpeed-Elektrodüsen, ein Vertrag über ein System mit zwei dieser Motoren unterzeichnet worden, von denen jeder eine Spitzenleistung von 300 kW und eine Dauerleistung von 200 kW hat.
Die Calypso ist 24 m lang und wird derzeit von zwei Dieselmotoren angetrieben. Durch die Umrüstung wird die Fähre in der Lage sein, bei einer Reisegeschwindigkeit von 18 Knoten (33,3 km/h) etwa sechs Stunden pro Tag rein elektrisch zu fahren. Die Umrüstungsarbeiten sollen Anfang 2022 beginnen, gefolgt von Probefahrten und dem Vollbetrieb im Jahr 2023.
Während dies das erste Nachrüstungsprojekt mit den DeepSpeed-Elektromotoren ist, hat das Unternehmen bereits andere, größere Schiffe wie die 400 Passagiere fassende Celestina auf Hybrid-Diesel-Elektro-Systeme umgerüstet. Bislang konnte der Umbau der Calypso aber nicht belegt werden. Der Name der maltesischen Captain Morgan Holdings Ltd. auf der Fähre rührt daher, daß sie zeitweise von Captain Morgan als Ausflugs- und Linienfähre auf Malta eingesetzt wurde.
Im August 2023 wird berichtet, daß die IGINIA,
eine Hybridfähre der Rete Ferroviaria Italiana (RFI),
die von den Werften T. Mariotti und San Giorgio
del Porto gebaut worden ist, wieder in der Straße von Messina
angekommen ist, wo sie kurz darauf ihren Dienst auf der Route Villa
San Giovanni (Kalabrien) – Messina (Sizilien) aufnimmt, als Teil der
Flotte von FS Italiane. Die Fähre ist für den Transport
von Eisenbahnwaggons, Lkw, Passagieren und Radfahrzeugen konzipiert
und erreicht eine Geschwindigkeit von 18 Knoten.

Nach dem Stapellauf in San Giorgio di Nogaro im September 2020 und anschließender Überführung nach Genua wurden die Hybridisierung und Endausrüstung erst 2023 abgeschlossen. Die Umstellung auf die Hybridtechnologie mit Dual-Fuel-System (Elektromotor und Diesel) umfaßte die Installation eines Elektromotors an jeder Antriebseinheit, der von Batteriesträngen gespeist wird und so dimensioniert ist, daß Anlege- und Auslaufmanöver alleine im Elektromodus möglich sind.
Die Batteriestränge werden von denselben Elektromotoren, die im Achsgeneratorbetrieb eingesetzt werden, während der Fahrt und/oder alternativ von den Hilfsgeneratoren oder im Hafen über den Landanschluß aufgeladen. Zudem ist das Schiff mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
Mit einer Länge von 147 m und einer Breite von 19 m hat die IGINIA die Kapazität, bis zu 27 Eisenbahnwaggons auf vier Schienen sowie rund 700 Personen (inkl. Besatzung) aufzunehmen. Für die Passagiere gibt es einen Bar- und Loungesalon mit 339 Sitzplätzen.
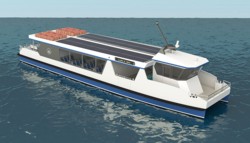
(Grafik)
Im Oktober 2023 erteilt die Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - die Kommunalbehörde für das Einzugsgebiet des Lago d’Iseo bei Bergamo - der Ostseestaal GmbH & Co. KG und ihrer Tochterfirma Ampereship den Auftrag zum Bau von zwei Elektro-Personenfähren. Die rund 26 m langen und 6,6 m breiten E-Katamarane, die künftig auf dem oberitalienischen See zum Einsatz kommen sollen, werden bis zu 140 Personen sowie sechs Fahrräder und einen Motorroller transportieren. Der Baubeginn ist für Anfang 2024 geplant.
Die beiden Neubauten - baugleich mit den drei Elektro-Personenfähren, die Ostseestaal für den Zürichsee in der Schweiz geliefert hat (s.o.) - werden jeweils über zwei elektrische Antriebe mit einer Leistung von je 100 kW und Ruderpropellern von Jastram verfügen. Den Strom liefern zwei Batteriepacks mit einer Gesamtkapazität von rund 750 kWh (andere Quellen: 800 kWh), die über Landstrom mit zwei 125 Ah Steckdosen sowie während der Fahrt über PV-Module aufgeladen werden, welche drei Viertel der Deckfläche beanspruchen und 11 kW liefern.

Die Geschwindigkeit der Leichtbau-Personenfähren wird mit 9,2 Knoten (17 km/h) angegeben, sie können aber in der Spitze bis zu 10,6 Knoten (19 km/h) erreichen. Ihre Auslieferung an den Betreiber Navigazione Lago d’Iseo erfolgt im Dezember 2024, woraufhin sie umgehend in Dienst gestellt werden - unter ihren zwischenzeitlich festgelegten Namen Sale Marasino II und Sarnico.
Ein besonderer Aspekt des Iseo-Projekts ist, daß die auf dem Ostseestaal-Gelände in Stralsund gebauten Schiffe in Sektionen geliefert und vor Ort zusammengebaut wurden, wodurch Transportprobleme und der Bedarf an einer lokalen Werft wegfielen. Die Montage jeder Fähre am Ufer des Iseo-Sees dauerte etwa vier Wochen, denen dann entsprechende Testfahrten folgten.
Die italienische Reederei Liberty Lines in Trapani, Sizilien, läßt im Juni 2024 eine Hybrid-Schnellfähre vom Stapel, die von einem mtu-Hybridantriebssystem von Rolls-Royce angetrieben wird, bei dem der batterieelektrische Teil für emissionsfreie Fahrten im Hafenbereich und als Booster genutzt wird.

Die von Incat Crowther entworfene und von der spanischen Werft Astilleros Armon gebaute 39,5 m lange Vittorio Morace, benannt nach dem Gründer der Reederei, hat eine Kapazität von 251 Passagieren, erreicht eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten und ist damit die „weltweit erste IMO HSC-Hybrid-Schnellfähre dieser Größe“, wobei HSC für High-Speed Craft steht.
Das neue Schiff ist die erste von neun Fähren, die zwischen Sizilien und den benachbarten Äolischen und Ägadischen Inseln sowie zwischen dem italienischen Festland, Kroatien und Slowenien verkehren werden.
Im August folgt die Meldung, daß die Holland Shipyards Group in
den Niederlanden für die GNL Italia S.p.A. - Teil
der Snam Group - ein vollelektrisches Doppelend-Ro-Ro-Schiff baut,
das für den Verkehr in den geschützten Gewässern von La Spezia konzipiert
ist. Die Route verläuft zwischen dem LNG-Terminal Panigaglia und dem
Hafen von La Spezia, weshalb die Fähre auch für die Beförderung von
vier speziellen LNG-Lkw ausgerüstet wird.
Der Antrieb des modernen Shuttle-Fährschiffs mit einer Länge von 50,2 m und einer Breite von 13,9 m erfolgt über zwei 300 kW Antriebsstrahler, die von einem Batteriesatz mit mehr als 1 MWh gespeist werden.
Ähnliches wird in den Blogs auch im März 2025 berichtet.
Diesmal geht es um den italienischen Binnenfährenbetreiber Gestione
Navigazione Laghi, der fast 100 Schiffe hat, die auf den drei
größten Seen Italiens, Garda, Maggiore und Como, fahren. Auch dieses
Unternehmen führt ein ehrgeiziges Modernisierungsprogramm durch, bei
dem es von ABB unterstützt wird.
Der jüngste Schritt ist der Austausch des konventionellen Dieselantriebs der 42 m langen Gardasee-Fähre Adamello durch ein sauberes, effizienteres Hybrid-Elektro-Antriebssystem. Die Umrüstung wird in der Werft in Peschiera del Garda durchgeführt.
In diesem Zusammenhang ist zu erfahren, daß die Gestione Navigazione Laghi bereits im Jahr 2021 die auf dem Lago Maggiore bis dahin rein dieselmotorisch betriebene San Cristoforo, Baujahr 1965, mit einem Hybridantrieb ausstatten ließ, was ebenfalls durch ABB erfolgte.
In Neuseeland nimmt die erste vollelektrische Fähre, die Ika Rere, im März 2022 ihren Betrieb auf. Der speziell für die Anforderungen der Wellington Harbour-Verbindung konzipierte Kohlefaser-Katamaran hat eine Länge von 19 m und eine Kapazität von 132 Passagieren (andere Quellen: 135). Er wird als Teil der Flotte des Fährbetreibers East by West Wellington Harbour Ferry Service täglich neun Fahrten auf einer Route zwischen den Anlegestellen Queens Wharf und Days Ba in der Bucht vor Wellington absolvieren.

Der Antrieb besteht aus zwei Elektromotoren mit je 325 kW, die von einem 550 kWh Lithium-Ionen-Batteriespeicher versorgt werden. Die normale Geschwindigkeit beträgt 20 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit 25 Knoten, und die Reichweite pro Ladung entspricht einer Hin- und Rückfahrt mit insgesamt 25 km, deren Energiebedarf 310 – 500 kWh beträgt, je nach Beladung und Geschwindigkeit. Zwischen den Ladevorgängen kann die Fähre eine Stunde lang kontinuierlich betrieben werden.
Verantwortlich für die Integration der 72 flüssigkeitsgekühlten Batteriepacks von XALT Energy (seit Dezember 2018 übrigens ein Tochterunternehmen der Freudenberg Sealing Technologies, FST) in zwei Batterieräumen ist die McKay Group. Geladen werden die Akkus mit erneuerbarem Strom, hauptsächlich aus Wind und Wasserkraft. Das Aufladen im Hafen über Nacht funktioniert mit mit 300 kW, daneben geht eine Schnelladeoption mit bis zu 1 MW, was dann ca. 15 Minuten dauert.
Das nächste Land, das den Umschwung beginnt, ist Singapur. Hier hat die Shell Singapore Pte Ltd., eine Tochter des weltweiten Energiekonzerns, in Zusammenarbeit mit dem lokalen Hersteller von Hochgeschwindigkeitsbooten aus Aluminium, Penguin International Ltd., das Projekt Electric Dream gestartet, das drei reine Elektrofähren, drei Schnelladestationen an Land und drei autonome Ladeausleger umfaßt. Dabei wird die Penguin International die Electric-Dream-Fähren und die Ladeinfrastruktur entwerfen, bauen, besitzen und betreiben.

Shell hat in den letzten Jahren mehrere Akquisitionen und Investitionen getätigt, um sich vom Geschäft mit fossilen Brennstoffen zu lösen. Das Unternehmen hat zudem Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingerichtet und mit neuen Übernahmen und Partnerschaften im Laufe der Zeit sein Ladeinfrastrukturnetz in ganz Europa auf fast 100.000 Anschlüsse erweitert. Daneben engagiert sich der Ölmulti auch für erneuerbare Energiequellen, wie z.B. bei dem Super-Hybrid-Offshore-Windpark in den Niederlanden, bei Solarfarmen, Batteriespeichern und ,grüner’ Wasserstoffproduktion.
Die aktuelle Zusammenarbeit ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Verringerung der Emissionen des Hafens von Singapur, einem der verkehrsreichsten Häfen der Welt, das u.a. vorsieht, daß alle neuen Hafenschiffe bis 2030 emissionsfrei sein müssen. So wird Shell auch dabei mitwirken, die erforderliche Ladeinfrastruktur einzurichten. Weitere Projektpartner sind Incat Crowther, Razor Blunt Labs, Danfoss, Zinus AS und Gema Engineering.

Electric-Dream-Projekts
Gemeinsam mit der Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) enthüllt Shell im April 2023 die erste Passagierfähre. Das neue, 28 m lange und 8 m breite Schiff mit dem Namen Penguin Refresh verfügt über ein Lithium-Ionen-Batteriesystem mit einer Kapazität von 1,2 MWh und erreicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 21 Knoten. Es wird im Mai in Betrieb genommen, die beiden Schwesterschiffe Penguin Recharge und Penguin Renewable folgen im August.
Die Elektrofähren mit einer Kapazität von 200 Passagieren werden täglich rund 3.000 Personen zwischen dem Pasir Panjang Ferry Terminal auf dem Festland und dem Energie- und Chemiepark von Shell auf der Insel Pulau Bukom befördern - was etwa 1,8 Mio. Fahrten pro Jahr entspricht. Während der Hauptverkehrszeiten benötigen die Gleichstrom-Schnelladegeräte an Land weniger als acht Minuten, um die Batterien um 400 kWh pro Fähre aufzuladen. Der Start des vollelektrischen Fährdienstes erfolgt im Januar 2024.
Im Zuge der Berichterstattung über das Electric-Dream-Projekt ist zu erfahren, daß die Penguin International bereits 2022 das erste hybrid-elektrische Patrouillenboot Singapurs, die MPA Guardian, an die Maritime and Port Authority of Singapore geliefert hat, gefolgt von einem hybrid-elektrischen Lotsenboot namens Penguin Tenaga an Shell sowie dem ersten hybrid-elektrischen Crew Transfer Vessel (CTV) an die EMO Logistics Singapore Pte Ltd., der regionalen Niederlassung von EMO Trans, einem globalen Anbieter für Transport-, Logistik- und Supply-Chain-Dienstleistungen.

Vermutlich ab 2024 ist eine Elektro-Solar-Passagierfähre in Kroatien in Betrieb, die im Rahmen einer Zusammenarbeit der Marservis Shipyard mit der Universität Zagreb entwickelt und mit Batterien der AYK Energy Ltd. ausgestattet wurde.
Die vollelektrische PROEco 60 (o. Pure Electric Passenger Ship) mißt 19 m in der Länge, 7,5 m in der Breite und bietet Platz für 100 Passagiere. Sie wird zur Personenbeförderung zwischen den kroatischen Inseln und dem Festland eingesetzt.
In Spanien präsentiert Baleària, die führende Reederei im Passagier- und Frachtverkehr auf den Verbindungen zu den Balearen, im Januar 2025 den ersten ,grünen Korridor’ zwischen Europa und Afrika - Tarifa in Südspanien und Tanger in Marokko -, der von zwei vollelektrischen Schnellfähren befahren werden soll. Baleària hatte im Dezember von der Hafenbehörde der Bucht von Algeciras (APBA) den Zuschlag für den Betrieb der ca. 29 km langen Strecke Tarifa - Tangier Ville für die nächsten 15 Jahre erhalten.

(Grafik)
Die Katamaranfähren, die als die „weltweit ersten vollelektrischen Interkontinental-Schnellfähren“ bezeichnet werden, sollen innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre auf der Armon-Werft in Gijón gebaut und 2027 in Dienst gestellt werden. Ihr Design ähnelt dem der erdgasbetriebenen Schnellfähren von Armon, wurde jedoch für die Häfen von Tarifa und Tanger Ville optimiert. Die neuen Katamarane haben eine Länge von 87 m und eine Breite von 25 m, bieten Platz für 804 Passagiere und 225 Autos und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 26 Knoten, wobei ein T-Foil-System vertikale Bewegungen dämpft. Dank Brückenquerrudern, zwei Bugstrahlern und vier Rudern sind sie äußerst manövrierfähig.
Im Oktober wird der in Andorra ansässige Spezialist für Energiespeichersysteme für marine und industrielle Anwendungen, AYK Energy Ltd., damit beauftragt, die Stromversorgung für die Fähren zu liefern. Jedes Schiff wird über eine elektrische Leistung von 16 MW verfügen, dank vier elektrischer Antriebseinheiten, die von Batterien mit einer Kapazität von 11,5 MWh (andere Quellen: 13,8 MWh) gespeist werden. Dies macht es möglich, die gesamte Reise ausschließlich elektrisch zurückzulegen. Für Notfälle verfügt jedes Schiff über vier Dieselgeneratoren mit einer Gesamtleistung von 11,2 MW.
Um die Batterien während des einstündigen Zwischenstopps in jedem der Häfen vollständig aufzuladen, werden in beiden Häfen 8 MWh Batterien installiert, die mit der Landstromversorgung (5 MW in Tarifa und 8 MW in Tanger) verbunden sind. Das Aufladen, das von autonomen Roboterarmen durchgeführt wird, benötigt nur 40 Minuten.
Im Zusammenhang mit dem Projekt ist auch zu erfahren, daß die Baleària über eine Flotte von elf gasbetriebenen Schiffen verfügt und ein Pionier bei der Nutzung elektrischer Energie ist: Seit 2023 hat sie zwei Schiffe mit Elektroantrieb in ihrer Flotte, die Cap de Barbaria (die erste elektrische Passagier- und Frachtfähre Spaniens mit Null-Emissionen bei Anfahrten und Hafenaufenthalten) und die Rusadir (eine Kreuzfahrtfähre mit Elektroantrieb, die mit zwei Erdgasmotoren betrieben wird).
Auch aus Malaysia gibt es etwas zu berichten: Hier veröffentlicht ein Forscherteam unter der Leitung von Wissenschaftlern der Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah im Oktober 2025 die im Netz einsehbare Arbeit mit dem Titel ,Offshore floating solar with electrofuels for refuelling small ferries: a techno-economic-environmental study’, in der ein System simuliert wird, das schwimmende Offshore-Photovoltaikanlagen mit Wasserstofferzeugung für die Betankung kleiner Fähren nutzt. An der Studie sind auch indische Forscher der ICFGS Foundation, der Manipal Academy of Higher Education und des Maulana Azad National Institute of Technology beteiligt.
Die Simulation umfaßt eine schwimmende PV-Anlage mit einer Leistung von 20 MW, bestehend aus 40.000 Solarmodulen, die mit einem Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem verbunden ist und eine Meerwasserentsalzungsanlage versorgt, welche das saubere Wasser in den PEM-Elektrolyseur leitet, um Wasserstoff zu erzeugen. Als Fallstudie wird die 250-Personen-Kurzstreckenfähre untersucht, die von Terengganu in Malaysia zur Insel Redang fährt und dabei eine Strecke von 60 km pro Hin- und Rückfahrt zurücklegt. Die Studie zeigt, daß ein solches schwimmendes Offshore-Solarsystem ausreicht, damit die Fähre zwei Hin- und Rückfahrten pro Tag absolvieren kann.
Nach diesem außerordentlich umfangreichen Schwerpunkt geht es mit der allgemeinen Jahresübersicht 2013 weiter, die noch mit einigen interessanten Entwicklungen aufwartet.
Im Juni geben die schon mehrfach erwähnten Incat
Crowther und Marine Engineering Consultants (MEC)
Pläne zum Bau eines 24 m langen Katamaran-Patrouillenschiffs bekannt,
das zum Schutz des Weltnaturerbes Great Barrier Reef eingesetzt werden
soll. Die Partner waren von dem Department of National Parks, Recreation,
Sport and Racing (DNPRSR) und der Great Barrier Reef Marine Park
Authority (GBRMPA) in Queensland aufgefordert worden, ein entsprechendes
Konzept zu entwickeln.

(Grafik)
Das Schiff verfügt über ein effizientes Rumpfdesign, eine hocheffektive Isolierung, eine zonengesteuerte Klimaanlage sowie Jalousien und Fensterläden, um die Auswirkungen der Sonne von Queensland zu reduzieren. Es wird mit Tauchflaschenständern, Platz für Computerarbeitsplätze und einem 6-m-Schlauchboot ausgestattet sein.
Der Katamaran, dessen Stapellauf für Anfang 2014 geplant ist, wird in den Blogs als solarbetrieben bezeichnet, was etwas übertrieben ist, denn die 6 kW PV-Paneele können kaum mehr als den Einsatz der Dieselgeneratoren während des Betriebs und bei nächtlicher Verankerung zu reduzieren, indem sie eine Reihe von Lithium-Ionen-Batterien aufladen, die den Strom für die Hauslasten einschließlich der Klimaanlage liefern. Bei erhöhtem Bedarf schalten sich die Generatoren automatisch ein. Ansonsten wird das Schiff von zwei Dieselmotoren mit einer Leistung von je 670 kW angetrieben, mit denen es Geschwindigkeiten von bis zu 25 Knoten erreichen kann.
Tatsächlich wird im Juni 2014 ein von Norman R. Wright & Sons gebautes Patrouillenboot ausgeliefert, das den Namen Reef Ranger bekommt und leicht veränderte Spezifikationen hat. Der Aluminium-Katamaran wird nun von einem 2.037 PS Verbrennungsmotor angetrieben, der eine Maximalgeschwindigkeit von 27 Knoten (50 km/h) erlaubt. Das neue Schiff kann zwölf Wochen lang außerhalb des Hafens operieren, hat eine Reichweite von bis zu 2.000 Seemeilen und kann im Tagesbetrieb bis zu 28 Personen befördern. Im Mai 2021 folgt die Reef Resilience, im September die Tamoya und im März 2023 die Tamoya II, doch Informationen über Hybrid- oder Elektroantrieb liegen nicht vor, weshalb die Sache hier nicht weiter verfolgt wird.
Zu den Geräten, die im Juni 2013 in den Blogs erscheinen, gehört der teilautonome Ziphius der im Vorjahr gegründeten portugiesischen Firma Azorean Aquatic Technologies - eine mit einer Kamera ausgestattete Schwimmdrohne, die mittels einer iOS- oder Android-App vom Smartphone oder Tablet aus über Wi-Fi aus einer Entfernung von bis zu 90 m ferngesteuert werden kann. Mit der App lassen sich nicht nur die Geschwindigkeit und die Richtung des Ziphius steuern, sondern auch eine Live-Übertragung der integrierten HD-Videokamera schalten.

Das Gehäuse der ca. 1,4 kg schweren Drohne besteht aus einer stoßfesten Kunststoff-Basiseinheit und austauschbaren Schaumstoff-Rückseiten, die abgenommen werden können. Diese sind für unterschiedliche Aufgaben konfiguriert, z.B. für den Transport von Getränken im Pool oder als GoPro-Kamerahalterung. Mit einem Servomotor läßt sich die Kamera nach oben neigen, um zu sehen, was sich über der Wasseroberfläche befindet, oder nach unten, um zu entdecken, was sich darunter verbirgt. Ist es dort zu dunkel, kann das LED-Licht der Kamera eingeschaltet werden.
Der Ziphius verfügt über eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die zwei Gleichstrommotoren mit jeweils einem podartigen Propeller antreibt. Diese Propeller können unabhängig voneinander vorwärts und rückwärts laufen, wodurch die Drohne auf der Stelle drehen kann. Und sollte sie bei rauher See umkippen, sorgt ihr Design dafür, daß sie sich selbständig wieder aufrichtet. Die Akkulaufzeit liegt bei einer Stunde pro Aufladung, eine Anzeige auf dem Kontrollbildschirm der App zeigt den aktuellen Batteriestatus an, und die maximale Vorwärtsgeschwindigkeit beträgt 9,7 km/h.

(endgültiger Prototyp)
Dank des integrierten Raspberry-Pi- und ATMEGA-Mikrocontrollers kann das etwa 40 x 25 x 20 cm große Wasserfahrzeug Dinge wie das Verfolgen eines farbigen Balls erledigen, der in seiner Nähe ins Wasser geworfen wird. Weitere auf KI basierende Fähigkeiten sind in Arbeit, ebenso wie Augmented-Reality-Spiele, die den Video-Feed des Bootes nutzen.
Azorean Aquatic Technologies startet nun eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, bei welcher der Ziphius ab 195 $ erhältlich ist, der spätere Preis wird 245 $ betragen. Die Kampagne ist erfolgreich, als der Zielbetrag von 125.000 $ durch 472 Unterstützer knapp überschritten wird, die gemeinsam 127.199 $ beitragen. Nun sind die ersten Auslieferungen für den März 2014 geplant.
Tatsächlich wird der endgültige Prototyp aber erst im September 2014 fertig, dafür hat er jetzt leicht austauschbare Motoren, rechts- und linksdrehende Propeller für ein stabileres Verhalten, sowie einen Sicherheitsschutz für die Turbinen. Im Oktober folgen Becken-Tests. Aus einer Nachricht von März 2016 ist jedoch zu entnehmen, daß die Produktion noch immer nicht aufgenommen wurde, was von der Firma auf die Wirtschaftskrise in Portugal geschoben wird.
Ein 3,8 m (andere Quellen: 5,5 m) langes und 63 cm breites, vollständig
solarbetriebenes und autonomes Roboterboot eine Atlantiküberquerung durchführen
zu lassen, ist das Ziel einer Gruppe von Studenten, die nach ein paar
Verzögerungen ihren Scout im August 2013 vor Sakonnet Point, Rhode Island, zu Wasser lassen. Er sendet einmal
pro Stunde seine Position, die in Echtzeit auf einer extra eingerichteten
Webseite verfolgt werden kann.

Die Idee aus dem Jahr 2010 stammt von Dylan Rodriguez, einem Studenten des Worcester Polytechnic Institute, und Max Kramers, der an der Escuela Técnica Superior de Ingeniería (TECNUN) in Spanien studiert, und startet als bescheidenes, aber erfolgreiches Kickstarter-Projekt. Der Rest des 7-köpfigen Teams, das im April 2012 mit den Arbeiten beginnt, die auf der Projekthomepage gut dokumentiert sind, stammt von anderen Colleges im Osten der USA. Das Projekt hat zwar Sponsoren und Unterstützer, ist aber nicht mit einem Unternehmen oder einer Universität verbunden.
Der von Grund auf neu gebaute Scout basiert auf einem speziell angefertigten Rumpf aus Kohlefaser mit einem Kern aus Divinycell-Schaumstoff und einem Zwiebelkiel, um das Boot bei schwerem Seegang aufzurichten. Der Antrieb erfolgt über einen elektrischen Trolling-Motor, der von einer Bank Lithium-Eisenphosphat-Batterien gespeist wird, die ihre Energie aus vier PV-Paneelen mit insgesamt 215 W beziehen.
Das Schiff soll einer vorprogrammierten, etwa 3.473 Meilen langen Route bis zu seinem Ziel Sanlucar de Barrameda in Spanien folgen, wo vor 515 Jahren Kolumbus seine eigene transatlantische Reise begonnen hatte. Darüber hinaus verläßt es sich auf Informationen über seine Umgebung, die es mit Hilfe seiner Sensoren sammelt. Nachdem das 72,5 kg schwere Roboterboot mehr als 1.300 Meilen autonom zurücklegt, bricht der Funkkontakt im November ab, und es wird angenommen, daß es gesunken ist.
Obwohl die Reise nicht erfolgreich beendet werden kann, ist das Projekt keineswegs gescheitert: Das Team stellt einen neuen Rekord für die längste Strecke auf, die ein autonomes Boot bislang zurückgelegt hat. Außerdem gründen die Teammitglieder ihre eigenen Unternehmen und sind inzwischen als Berater für ähnliche Industrieprojekte tätig.
Hinweis: Bereits 2004 hatte das MIT ein Roboterboot mit dem gleichen Namen SCOUT gebaut und betrieben (s.d.). Eine erfolgreiche und rekordbrechende autonome Ozeanüberquerung von San Francisco bis nach Hervey Bay in Australien absolvierte zwischen November 2011 und Dezember 2012 der Papa Mau von Liquid Robotics. Da es sich dabei um einen mit Wellenenergie betriebenen Wave Glider handelt, wird dieses Projekt unter den wellenbetriebenen Schiffen und Booten aufgeführt. Autonome elektrische, hybride und solarbetriebene Boote und Schiffe werden in einer späteren Jahresübersicht als Schwerpunkt behandelt (in Arbeit).
Im Oktober findet die PlugBoat 2013 statt, die 1.
Internationale Elektro- und Hybrid-Boot-Konferenz mit mehr
als 60 Beiträgen aus 17 Ländern. Ausgerichtet wird der Kongreß, der
direkt am Mittelmeer und in unmittelbarer Nähe des Yachtclubs von Nizza
stattfindet, von der belgischen Organisation Electri-City.mobi
asbl, einem Open-Directory-Projekt für saubere Transportlösungen
und nachhaltige Mobilität. Die Teilnahmegebühr beträgt 550 €.
Vom Fokus her ist er auf kleinere Elektroboote und die damit verbundene Technik im Wassersportbereich ausgerichtet. Neben der Darstellung der unterschiedlichen E-Boot-Typen werden Einblicke in die verschiedenen Märkte gewährt, Wachstumspotentiale und Zukunftsperspektiven aufgezeigt und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge in den verschiedenen Ländern diskutiert. Am zweiten Konferenztag erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, E-Boote selbst zu testen.
Die Pionierveranstaltung bleibt aber wohl eine einmalige Sache, denn es lassen sich keinerlei Spuren irgendwelcher Folgekongresse finden. Es dauert bis zum Juni 2025, bis in Amsterdam die erste Electric & Hybrid Marine Expo Europe stattfindet, die sich dann aber mit der umfassenderen maritimen Elektrifizierung und Hybridisierung in der kommerziellen Schiffahrt beschäftigt.

Ebenfalls im Oktober 2013 präsentiert ein Team unter der Leitung von Prof. Hyun Myung vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) eine Lösung für das Problem, daß die Quallenpopulationen an der südkoreanischen Küste in den letzten Jahren so stark angestiegen sind, daß sie die Fischpopulationen und die Meeresindustrie in dem Gebiet beeinträchtigen und jedes Jahr Schäden in Höhe von fast 300 Mio. $ verursachen. Darüber hinaus mußten in Südkorea im Vorjahr über 2.000 Menschen wegen Quallenstichen behandelt werden.
Versuche des National Fisheries Research & Development Institute, das Problem zu bekämpfen, indem die Region mit Netzen befischt und natürliche Quallenjäger freigelassen werden, erweisen sich entweder als zu kostspielig oder als unwirksam.
Myung und sein Team arbeiten seit 2009 an einer robotergestützten Methode zur Lösung des Problems und haben mit dem Jellyfish Elimination RObotic Swarm (JEROS) im vergangenen Jahr den ersten erfolgreichen Feldtest durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von elektrisch betriebenen, autonomen, schwimmenden Robotern, die zusammenarbeiten, um Quallen im Meer aufzuspüren und zu zermahlen. Nun hat die Gruppe die Geschwindigkeit und die Programmierung ihrer Erfindung so verbessert, daß sie viel schneller arbeiten kann.
Stabil über Wasser gehalten wird jeder JEROS-Roboter von zwei Pontons mit motorisierten Propellern, die gleichzeitig seine Geschwindigkeit und Richtung steuern. Eine Kamera scannt die Wasseroberfläche, und der eingebaute Computer verarbeitet die Bilder, um Quallen in Reichweite anhand ihrer Form zu identifizieren. Entlang der Breite des Roboters ist unter Wasser ein quadratisches Netz aufgehängt, in welches er mit Hilfe seines eigenen Antriebs Quallen in der Nähe hineinzieht. Die Quallen, die aufgeschnappt werden, werden direkt in einen separaten Propeller geleitet, der sie sofort zu einem Brei zermalmt, welcher sich im Wasser verteilt - was man auch in einem Video sehen kann.

Um seinen Standort im Ozean auf 1,5 m genau zu bestimmen, nutzt der Roboter eine Kombination aus GPS und Trägheitsnavigationssystem (INS), und die Forscher können drahtlos Daten über aktuelle Quallen-Hotspots auf den Bordcomputer von JEROS hochladen, so daß er selbständig einen Kurs zu diesen Gebieten berechnen und diese ansteuern kann.
Da ein einzelner Roboter jedoch viel zu lange bräuchte, um die Quallenkonzentration merklich zu verringern, konzentriert sich ein großer Teil des Projekts auf die Entwicklung eines Algorithmus, mit dem sich mehrere Roboter koordinieren können. Während sie im Schwarm unterwegs sind, tauschen die Roboter drahtlos Informationen über ihren Standort aus, um sicherzustellen, daß sie gleichmäßig voneinander getrennt bleiben.
Bei einer Testreihe in der Gyeongnam Masan Bay mit drei JEROS-Bots, die sich mit einer Geschwindigkeit von 4 Knoten (7,4 km/h) bewegen, sind diese in der Lage, pro Stunde 900 kg Quallen auszurotten. Neben der Bewältigung des koreanischen Quallenproblems könnte das Projekt auch für andere Aufgaben im Wasser eingesetzt werden, z.B. die Säuberung der Meere und ihre Überwachung.
Weitere Details der Entwicklung und der damit verbundenen experimentellen Ergebnisse werden in der leider nicht frei einsehbaren Studie ,Development and experimental testing of an autonomous jellyfish detection and removal robot system’ aufgeführt. Da das Projekt eine Laufzeit vom Mai 2010 bis zum April 2016 hat, kann man sicherlich noch weitere Fortschritte erwarten.
Im November 2013 endet eine Crowdfunding-Kampagne auf indiegogo ohne den erhofften Erfolg, denn von dem Zielbetrag von 35.000 $ kommen nur 12.085 $ zusammen. Dabei ist die Idee eines elektrischen Unterwasserantriebs für Taucher des im Vorjahr von Simon und Chris Parke gegründeten britischen Start-Ups S.C.P Marine Innovation Ltd. aus Portsmouth alles andere als dumm.

Jet Pack
Das X2 Underwater Jet Pack (o. x2 Sport Underwater Jet Pack), mit dem man wie ein menschlicher Torpedo durchs Wasser jagen kann, ist ein einzigartiges, am Arm getragenes Antriebssystem, das einen starken Vektorschub erzeugt und Tauchern und Freitauchern eine neue Möglichkeit bietet, einfach unter Wasser herumzufliegen oder Freestyle-Unterwasserakrobatik zu praktizieren.
Das 3.500 £ teure Gerät, das eigentlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen sollte, verwendet zwei Propeller, die an der Außenseite der Unterarme des Benutzers befestigt sind, mit Lithium-Batterien betrieben und drahtlos gesteuert werden. Der aktuelle Prototyp erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 10 km/h, was viel schneller ist, als ein Mensch schwimmen kann.
Im Oktober 2015 wird zwar berichtet, daß sich ein neues sSport Underwater Jet Pack im Betatest befindet, während über eine Crowdfunding-Kampagne das neue Gerät für 2.000 $ angeboten wird - doch danach hört man nie wieder davon. In den anschließenden Jahresübersichten wird aber klar, daß die Idee damit längst nicht abgehakt ist.
Mehr über derartige elektrische Hilfsantriebe für Schwimmer und Taucher findet sich in der Jahresübersicht 2016 unter dem Schwerpunkt Unterwasserjets und -scooter.
Weiter mit den Elektro- und Solarschiffen...